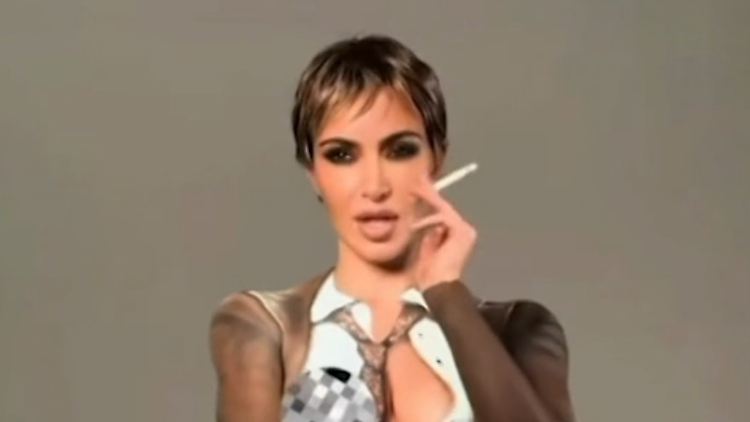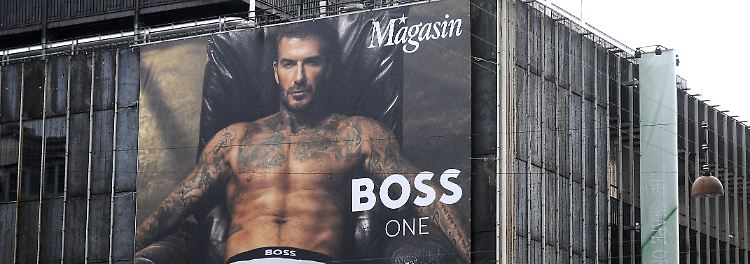Tabori-Uraufführung am BE Wuttke macht "pffft"
16.11.2007, 12:58 Uhr"...und mein Wrack macht endlich pffft" sind die letzten Worte eines langen Monologs, den der im Juli im Alter von 93 Jahren gestorbene Autor und Regisseur George Tabori hinterlassen hat. Die Uraufführung des Monologs unter dem Titel "Pffff oder Der letzte Tango am Telefon" läuft seit Donnerstag auf der Bühne des Berliner Ensembles (BE). Auf ausdrücklichen Wunsch Taboris, der 1999 mit Claus Peymann von Wien als Hausautor und -regisseur ans BE ging, inszenierte und spielt Martin Wuttke die etwas mehr als einstündige "Solo-Performance" (mit mehreren Nebendarstellern als antiker weiblicher Chor und einem "Gevatter Tod" mit Sense und Kapuzenkutte). Ein Mann wartet sehnsüchtig auf den Anruf einer Frau und lässt dabei sein bisheriges Leben Revue passieren. Es wird kein großer Theaterabend. Zu erleben ist aber eine sehenswerte Schauspielerleistung. Wuttke, der seit über zehn Jahren am BE als Brechts "Arturo Ui" in Heiner Müllers letzter Inszenierung auf der Bühne steht, gibt "seinem Affen auch mal Zucker" und treibt die groteske Satire auf die Spitze.
Zusammen allein
"Man kann die Toten nicht daran hindern, ihre Witze wieder und wieder zu erzählen", heißt es in dem Stück, das - wie bei Tabori gewohnt - voller sarkastisch-ironischer Sentenzen und deftiger Ausdrücke (wie "Hirnwichser" und dergleichen) ist. Ein letztes Mal treibt Tabori mit dem Entsetzen und der Einsamkeit der Menschen Scherz, mit ihren Träumen und Hoffnungen, über die Lust und den Frust der "einsamen Zweisamkeit" oder "zweisamen Einsamkeit".
"Es geht um einen Entertainer, der nicht mehr an seine eigenen Scherze glaubt, bitter und boshaft auch gegen sich selbst wird", sagte Wuttke über die schon 1981 geschriebene Erzählung Taboris. "Warum nur all diese Qual", fragt sich der Mann im Stück und philosophiert: "Ich will nicht glücklich sein, ich will gut sein."
Auf dem Tisch tanzen
Wuttke spielt in der Maske eines verzweifelten, aufgedrehten Unterhalters oder Conferenciers im buntkarierten Sakko mit Perücke, übergroßer Hornbrille und weit offener, behaarter Hemdbrust mit Goldkettchen. Ein Chor von antiken Chorweibern kommentiert, treibt die Handlung voran und übernimmt einzelne Rollenpartien des imaginären Gesprächspartners am Telefon, das in Wahrheit nie klingelt. Wuttke rennt den ganzen Abend über einen langgezogenen Holztisch im Foyer des Theaters, um den die Zuschauer wie an einer großen Tafel herumsitzen.
Darunter ist auch der 76-jährige Dramatiker Rolf Hochhuth, der unversehens den Hauptdarsteller und den unheimlichen Sensenmann neben sich sitzen hat und die Stirn runzelt, als die Chorweiber auf dem Tisch langsam auf ihn zukriechen. Die Ohren müssen ihm wie allen Zuschauern gedröhnt haben, als Wuttke auf dem Tisch einen Schreckschussrevolver abfeuert, was in dieser nahen Distanz schon fast an Körperverletzung grenzt. Hochhuths Miene versteinert sich, als der Weihrauch schwenkende Sensenmann ihm "auf die Pelle" rückt. Am Ende gibt es viel Beifall für einen kurzweiligen Abend am früheren Brecht-Theater, den der Hausherr Claus Peymann im Hintergrund beobachtet. Er sitzt an der Tür zum einstigen Direktorenzimmer Bertolt Brechts und Helene Weigels.
Von Wilfried Mommert, dpa
Quelle: ntv.de