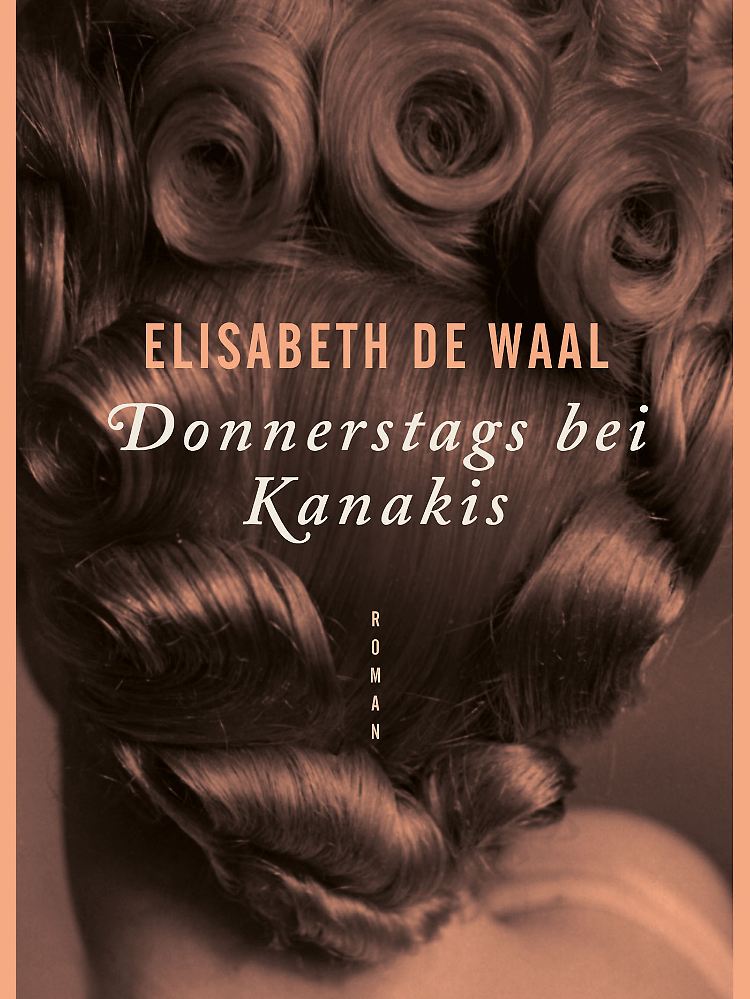Wiener Literaturerbe Die fremden Rückkehrer
20.04.2014, 15:39 Uhr
Das Palais Ephrussi in Wien: "Visitenkarte einer unendlich reichen und aufstiegsorientierten Familie" (Edmund de Waal)
(Foto: Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1888)
Eine junge Amerikanerin stirbt im Haus eines Millionärs an Schusswunden. Das in "Donnerstags bei Kanakis" von Elisabeth de Waal beschriebene Wien der 1950er-Jahre macht diesen Satz vollkommen plausibel.
"Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit. Bedenken Sie das, Herr Professor. So vieles hat sich verändert." Als er seine zänkische Frau und die ungeliebte neue Heimat New York wieder verlässt, ist Kuno Adler auf Veränderungen vorbereitet. Aber der jüdische Wissenschaftler hat nicht damit gerechnet, von seiner Heimatstadt Wien so kühl empfangen zu werden. Die durch das Reparationsgesetz gesetzlich versprochene Wiederherstellung des einstigen Status Quo wird von den Behörden zögerlich bis widerwillig durchgeführt. Alte Freunde haben nicht gerade auf ihn gewartet, einzig der treue Hausmeister seiner Universität freut sich über seinen Anblick. Doch deswegen muss Adler nicht weinen. Auch dass sein neuer Kollege während der "außerordentlichen Zeit" Experimente an KZ-Häftlingen durchgeführt hat, entsetzt ihn nicht. Nein, die Tränen kommen erst, als er bemerkt, dass die Bäume nicht mehr am Ring stehen, in diesem fremden Nachkriegswien.
Eine ganz andere Rückkehr erlebt Theophil Kanakis. Der Millionär will dabei sein, wenn das Land wiederaufgebaut wird. Aber nicht, um Geld zu verdienen, sondern um welches auszugeben. Und sich zu amüsieren. Kanakis, Nachkomme der kleinen, aber erlesenen griechischen Gemeinde Wiens, belebt die Salontradition wieder und versammelt jeden Donnerstag die junge Haute-Volée um sich. Schillernde, aber verarmte Gestalten, wie der junge Fürst Grein-Lauterbach, sollen seinen Hofstaat bilden - er sammelt sie wie seine Kunstgegenstände. In diese Kreise gerät die junge, unerfahrene Marie-Theres. Von ihren Eltern nach Europa geschickt, um ihre lethargische Melancholie zu überwinden und die Heimat der adligen Mutter kennenzulernen, findet sie sich in einer Gesellschaft wieder, deren Regeln sie nicht versteht. Und deren Dekadenz sie umbringen wird.
Exil und Rückkehr, Liebe und Zorn

"Warum bemühe ich mich so sehr, dieses Buch zu schreiben, das niemand lesen will? Weil ich immer geschrieben habe." - Elisabeth de Waal (Foto: Archiv Edmund de Waal)
"Elisabeth de Waal war Wienerin und dies ist ein Roman über das Wienersein", schreibt ihre Enkel Edmund de Waal in einem Vorwort zu "Donnerstags bei Kanakis". Seine Großmutter habe über Exil und Rückkehr geschrieben. Und über die widerstreitenden Kräfte von Liebe und Zorn gegenüber einem Ort, der zur eigenen Identität gehört, einen aber auch abgewiesen hat, so de Waal über das mit etlichen Tipp-Ex-Korrekturen versehenen Typoskript. Das wurde dem britischen Keramik-Professor vor Jahren von seinem Vater zur Aufbewahrung überreicht und machte ihm zum Hüter des Familienarchivs. Die Geschichte seiner Familie ließ den britischen Keramikkünstler und Professor fortan nicht los. Dass der zu Lebzeiten von Elisabeth de Waal (1899-1991) nie gedruckte Roman nun doch noch erschienen ist, liegt vor allem an dem Überraschungserfolg, den ihr Enkel mit dem 2010 veröffentlichten Familien-Roman "Der Hase mit den Bernsteinaugen" hatte.
Das darin beschriebene "Palais Ephrussi" war Elisabeths Heim. Die Anekdoten und tragischen Geschichten aus dem Leben der jungen, jüdischen Baronesse, ihr Exil und ihr zehnjähriger Kampf um die nach dem "Anschluss" 1938 geraubten Kunstschätze und das Eigentum der Familie, machen die spannendsten Teile des "Hasen mit den Bernsteinaugen" aus. Und schimmern auch immer wieder bei "Donnerstags bei Kanakis" durch. Wie in der Szene, als Kanakis seinen Makler nach zwei jüngst erworbenen Gemälden befragt, die an der Bürowand hängen. Woraufhin dieser nervös einräumen muss, dass die Bilder einst einem gewissen Baron E. gehörten und von ihm zwar sehr günstig, aber völlig legal im Auktionshaus erworben wurden.
Mit Professor Adler und Marie-Theres kehrt Elisabeth de Waal selbst in die Heimat zurück. Die Orientierungslosigkeit und Enttäuschungen des klassischen Rückkehrers Adler dürften ihre gewesen sein. Gleichzeitig zeichnet de Waal das Portrait einer Gesellschaft, die sich mit aller Kraft bemüht, den Krieg und seine grauenhaften Folgen als bedauerliche Episode abzutun, die den Kern des Wienerischen nicht berührt hat. Adlers Befriedigung in seinem Institut endlich einmal auf einen offen reuelosen Nazi zu treffen, erklärt sich angesichts dessen Frage, die sich auch de Waal bei ihrer Rückkehr gestellt haben mag: "Wo sind sie alle hin?"
Man hätte an dieser Stelle noch gerne mehr erfahren über das Zusammenleben von Opfern und Tätern im Nachkriegswien, doch Elisabeth de Waal ging es auch um andere Themen: Um das verschobene Gleichgewicht zwischen dem verarmten einstigen (Geld-)Adel und den Neureichen etwa. Und um die veränderte Stadt und was an ihr in den 1950er Jahren noch wienerisch gewesen sein mag. Und schließlich auch um all die überkommenen Konventionen, an denen auch in diesen "neuen" Zeiten festgehalten wurde, wie beispielsweise die Notwendigkeit Homosexualität zu verstecken.
Einige Kritiker beschrieben "Donnerstags bei Kanakis" deshalb als oberflächlichen, altmodischen Roman, der Redewendungen enthalte, die an Heimatromane erinnere. Spöttisch wird etwa auf die bewundernde Beschreibung eines blauen Enzians hingewiesen. Doch das ist die Sicht eines Lesers von heute. Auch wenn er jetzt erst erscheint: Elisabeth de Waal hat einen zeitgenössischen Roman geschrieben und kann nicht geahnt haben, welche Metaphern heute abgeschmackt wirken könnten. Sie hat die damaligen aktuellen Themen der Gesellschaft, in der sie sich bewegte, aufgegriffen. Und genau das macht "Donnerstags bei Kanakis" zu einem fesselnden Zeitzeugnis.
"Donnerstags bei Kanakis" bei Amazon bestellen
Quelle: ntv.de