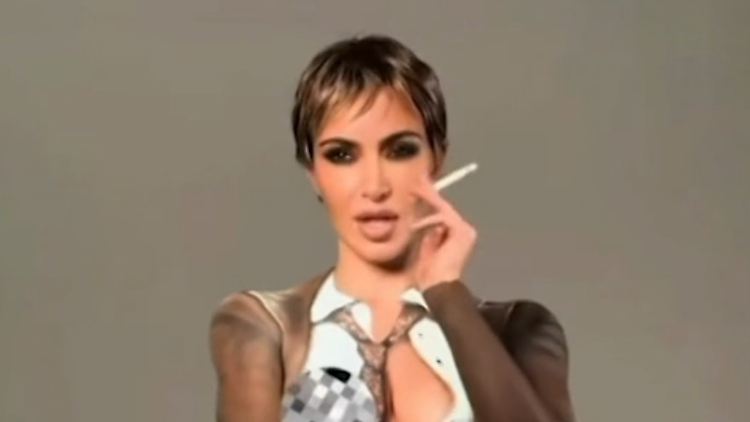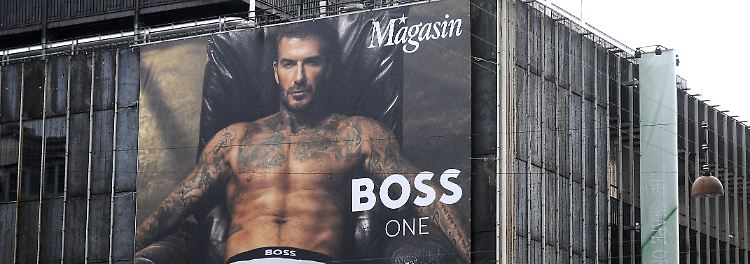"Buch der verbrannten Bücher" Ein Bruch mit 131 Splittern
10.05.2008, 18:18 UhrHeinrich Mann, Erich Kästner und Erich Maria Remarque. Stefan Zweig, Arnold Zweig und Alfred Döblin. Egon Erwin Kisch, Kurt Tucholsky und Bertolt Brecht. Nicht alle Autoren, deren Bücher am 10. Mai 1933 in Berlin und 21 weiteren Universitätsstädten in Flammen aufgingen, sind vergessen. Auch wenn viele nach 1945 nicht an ihre Erfolge vor dem Krieg anknüpfen konnten.
Vor dem Nichts
Und doch hat der Deutsche Kulturrat den Nationalsozialisten mit ihrer "Aktion wider den undeutschen Geist" einen "nachhaltigen Erfolg" bescheinigt. Denn etliche der Schriftsteller, die in den 20er Jahren oder davor zu den bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellern zählten, kennt heute niemand mehr. Zu lange waren sie getrennt von ihrem Publikum, standen im Exil vor dem Nichts und mussten nach ihrer Rückkehr, falls sie denn zurückkehrten, feststellen: Die Deutschen wollten sie nicht mehr.
Die Namen der Autoren "sollten ausgelöscht werden aus den Geschichtsbüchern, ausgelöscht aus dem Gedächtnis des Landes, ihr Bücher sollten spurlos verschwinden - für immer", schreibt Volker Weidermann im Vorwort zu seinem "Buch der verbrannten Bücher", das zum 75. Jahrestag im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen ist. Und er setzt hinzu: "Es ist fast gelungen."
M ühsame Spurensuche
In teils mühevoller Kleinarbeit hat sich der Literaturredakteur und Feuilletonchef der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" auf die Suche gemacht. Sowohl nach den heute noch bekannten Schriftstellern, als auch nach den fast vergessenen Autoren und ihren Werken, die oft genug nur noch antiquarisch erhältlich sind.
131 Biographien, oder besser: Schlaglichter sind entstanden. Es sind die 131 Namen, die auf der ersten "schwarzen Liste" des Bibliothekars und Nationalsozialisten Wolfgang Herrmann standen, die der Deutschen Studentenschaft, Organisator der Bücherverbrennung, als Grundlage diente. Es handelt sich dabei ausschließlich um Werke der schönen Literatur.
Subjektive Eindrücke
Weidermann geht es dabei keinesfalls um eine vollständige Auflistung der Lebenswege. Auch nicht um eine literaturwissenschaftliche Analyse, was angesichts der stilistischen Bandbreite und auch biographischen Verschiedenartigkeit ohnehin nahezu aussichtslos gewesen wäre. Viel eher gibt er subjektive Eindrücke wieder, die die verbrannten Werke "so plastisch wie möglich" vor den Augen des Lesers entstehen lassen sollen.
Dies ergibt sich einerseits aus der Darstellung der Leseerfahrungen, die Weidermann gemacht hat, wobei er feststellt, dass nicht alle Bücher den Qualitätsstandard halten können. Andererseits versucht er zu beschreiben, wie die Autoren nach der Verbrennung ihrer Bücher leben konnten, wie sie das Fanal begreifen konnten, oder ob sie sich nie davon erholt haben.
Lücken tun sich auf
Er sammelt biographische Bruchstücke und Begebenheiten, verfolgt - ohne Pathos - die Schicksale im Exil und nach 1945. Dabei muss er auch immer wieder Abstriche machen, weil sich Lücken auftun, weil Biographien kein Ende haben, weil Bücher nicht mehr auffindbar sind.
Ein Großteil der Spannung des Buches ergibt sich daraus, dass Weidermann nach dem Neuen sucht, nach dem Unbekannten. Die Abschnitte über die auch heute noch gelesenen Autoren geraten entsprechend kürzer, da sie kaum Neuigkeiten enthalten, vielen Lesern ohnehin bekannt sind. So gelingt es ihm, gerade den vergessenen Autoren wieder Leben einzuhauchen, sie in den Kontext zu stellen, aus dem sie gerissen wurden, als sie von Studenten dem Feuer übergeben wurden.
Internationale Autoren
Entstanden ist ein sehr lesenswertes Buch, das keinesfalls die Autoren abhakt oder zur trockenen Sammlung verkommt. Lediglich bei der Auflistung der 37 fremdsprachigen Autoren, zu denen auch Ernest Hemingway und Jack London, Jaroslav Hašek und Maxim Gorki zählten, fasst sich Weidermann sehr kurz - beschränkt sich teilweise auf die Aufzählung der Namen.
Und auch Autoren wie Karl Marx und Sigmund Freud, Theodor Wolff und Georg Bernhard, Friedrich Wilhelm Förster und Carl von Ossietzky, fehlen in dem Buch, obwohl sie in den von den Organisatoren für verbindlich erklärten "Feuersprüchen" persönlich genannt werden.
Ihre Hinzufügung hätte den Eindruck des Bruchs durch die Bücherverbrennung noch verstärkt, da nicht nur Schriftsteller, sondern auch Journalisten, Wissenschaftler und Philosophen, ja ganze Forschungszweige ins Exil getrieben wurden.
Liste ohne Ende
Andererseits ist eine vollständige Auflistung der verbrannten Autoren kaum möglich. Die "schwarze Liste" wurde ständig erweitert und die Bücher einiger Autoren, die auf der Liste fehlten, wurden in einigen Städten dennoch verbrannt, darunter Thomas Mann.
Weidermanns Buch mag nicht die erste Zusammenfassung verbrannter Autoren sein. Aber seine Prägnanz dürfte viele Schriftsteller zumindest ins Gedächtnis zurückrufen und verdeutlichen, wie stark der Schaden war, den die Nationalsozialisten der deutschen Vorkriegsliteratur zufügten.
Weidermann, Volker: "Das Buch der verbrannten Bücher". Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008. 256 Seiten, gebunden, 18,95 Euro.
Quelle: ntv.de