Die Zahlen im Verlauf der JahreSo erklären die Daten das PISA-Debakel
 Von Lukas Wessling
Von Lukas Wessling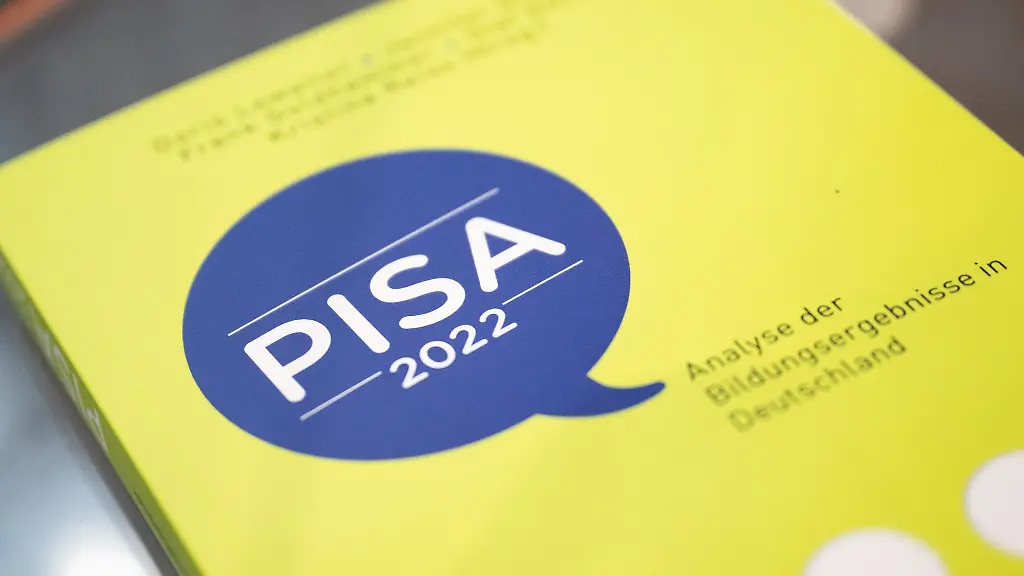
Deutschland erlebt den nächsten PISA-Schock. Schnell werden verschiedenste Erklärungsansätze und Deutungen ausgebreitet. Ein Blick auf ausgewählte Zahlen der vergangenen Jahre ermöglicht eine Einordnung der wichtigsten Argumente.
Angefangen hat das Elend mit der Jahrtausendwende. Deutschland, das selbsternannte Land der Dichter und Denker, fällt im Jahr 2001 aus allen Wolken: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im Jahr zuvor eine internationale Studie aufgelegt, mit der sie die Bildungssysteme verschiedener Staaten vergleichbar machen will. Das "Programme for International Student Assessment" (PISA) soll die schulischen Leistungen von 15-Jährigen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen messen.
Gegen Ende des Jahres 2001 dann erscheinen die Ergebnisse der Studie. Das mediale Echo ist überwältigend, Verantwortliche in der Politik zeigen sich erschüttert, bald ist vom "PISA-Schock" die Rede. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Ludwig Georg Braun, sagt: "Schlimmer hätte es nicht kommen können."
Deutschland schließt schlechter ab als der große Nachbar Frankreich, schlechter als der Durchschnitt aller OECD-Staaten, deutlich schlechter als die in den folgenden Jahren viel beachteten Finnen. Dieses böse Erwachen führt zu zahlreichen Reformversuchen, aber auch zu heftigen Diskussionen. Im Streit um die Frage, ob das dreigliedrige Schulsystem möglicherweise Ungleichheiten in der Gesellschaft zementiere, steht zwischenzeitlich ein Ausstieg Deutschlands aus der PISA-Studie im Raum.
Nach dem PISA-Schock kann Deutschland aber Fortschritte verzeichnen: Ab 2006 erzielen die getesteten Kinder aus der Bundesrepublik bessere Ergebnisse als die Vergleichsschüler in Frankreich und im Durchschnitt der anderen OECD-Staaten. Machte der Abstand zur Leseleistung der Finnen bei der ersten PISA-Studie noch ein Achtel des deutschen Ergebnisses aus, schrumpfte dieser Wert bis 2015 auf weniger als ein Zwanzigstel.
Die Aufholjagd geschieht mit freundlicher Unterstützung der Finnen, die ihrerseits stark nachlassen. Bei den Mathetests wird das besonders deutlich: Lag deren Ergebnis zu Beginn durchschnittlich knapp ein Zehntel über dem der deutschen Schülerinnen und Schüler, wird dieser Vorsprung bis zum Jahr 2015 auf ein Hundertstel gestutzt.
Während der Pandemie an Grenzen gekommen
Aber auch der deutsche Aufwärtstrend hat sich spätestens Mitte des letzten Jahrzehnts erledigt. Bei den Mathetests lassen die Leistungen schon 2012 wieder nach. Zwischen den Studien 2018 und 2022 liegt in den meisten getesteten Ländern ein deutliches Gefälle. In Deutschland ist der Absturz besonders deutlich: Das Ergebnis ist so schlecht wie nie, schlechter als im Schockjahr 2000. Im Mathetest erreicht der Abstand zum OECD-Durchschnitt 2012 seinen Höhepunkt, mittlerweile ist er um das Zehnfache geschmolzen.
Dafür werden unter anderem die Schulschließungen während der Corona-Pandemie verantwortlich gemacht. Unter anderem durch Corona sei das deutsche Schulsystem "an seine Grenzen" gekommen, sagt Stefan Dull, der Präsident des deutschen Lehrerverbands gegenüber ntv.
Deutschland liegt im europaweiten Vergleich tatsächlich vorn, was Schulschließungen angeht. Wie lange die Schultore geschlossen blieben, variiert aber über Europa hinweg stark. Dieser Wert alleine also kann die PISA-Ergebnisse nicht alleine erklären. Das ifo-Institut weist hier auf die Ausgangslage vor der Pandemie hin: Der Stand der Digitalisierung habe den Unterricht aus der Distanz erschwert. In einer ifo-Studie zu Europas Schulen in der Pandemie heißt es: "Deutschland liegt in Bezug auf Online-Lernplattformen und Ressourcen auf den letzten Rängen."
Selbst in der schlichten Verlaufsdarstellung der PISA-Ergebnisse aber ist zu erkennen, dass schon Mitte des letzten Jahrzehnts der Abschwung begann. Genauer: bei den Mathetests im Jahr 2012, beim Lesen dann 2015. Viele Fachleute sind sich sicher: Die Pandemie ist nicht die Ursache des Leistungsabfalls, sie beschleunigte den Niedergang nur. Sie machte deutlich und weithin sichtbar, was für die Menschen im Bildungssystem längst klar war.
"Es fehlen Fachkräfte, die Migration hat zugenommen"
"Diesen Trend beobachten wir seit rund zehn Jahren. Corona hat ihn lediglich verstärkt", bestätigt der Soziologe Aladin El-Mafaalani dem "Stern". Die Baustellen, die Expertinnen und Experten sehen, sind vielfältig: Die Digitalisierung verläuft schleppend, das Elternhaus ist noch immer ausschlaggebend für den Erfolg in der Schule, die vorhandenen Lehrkräfte sind überlastet. "Das deutsche Schulsystem ist heruntergewirtschaftet, es fehlen Fachkräfte. Und die Migration hat zugenommen", sagt El-Mafaalani.
Tatsächlich besuchen immer mehr Kinder deutsche Schulen, in deren Familie es eine Zuwanderungsgeschichte gibt. Kinder, die ihre Schullaufbahn im Ausland gestartet haben, die zu Hause mit ihren Eltern vor allem Ukrainisch, Türkisch oder Farsi sprechen. Kinder, die in ihren Familien eine Fluchterfahrung zu verarbeiten haben, denen zu Hause niemand bei den Hausaufgaben helfen kann. Aber auch Kinder, die ihren Mitschülern und Mitschülerinnen immer schon eine Fremdsprache voraus haben, sowie Kinder, die fließend Deutsch sprechen und sonst nichts.
Laut Mikrozensus hatten 2008 rund 28 Prozent aller Kinder an deutschen Schulen einen Migrationshintergrund, 2022 waren es mehr als 41 Prozent. Diese Kinder schneiden in den PISA-Studien teilweise sehr viel schlechter ab. Dabei haben das Geburtsland und die Sprache, die im Elternhaus vorwiegend gesprochen wird, großen Einfluss auf die Testergebnisse: Im Ausland geborene Kinder erzielten in der letzten PISA-Studie durchschnittlich weniger als 80 Prozent der Punkte, die in Deutschland geborene Kinder erhielten. Im OECD-Durchschnitt sind das mehr als 90 Prozent.
Welche Sprache zu Hause gesprochen wird, hat nicht nur auf die Lesekompetenz großen Einfluss. Auch das Mathematikverständnis hängt stark davon ab: Wird zu Hause vor allem Deutsch gesprochen, erzielen Kinder bei PISA im internationalen Vergleich achtbare Ergebnisse. Mit durchschnittlich 494 Punkten liegt diese Gruppe im Mathetest deutlich vor dem OECD-Mittel und sogar vor der finnischen Vergleichsgruppe.
Hinter dem Migrationshintergrund lauert ein anderer Faktor
Ganz anders bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, in deren Elternhaus eine andere Sprache dominiert: Diese Gruppe liegt mit 419 Punkten im Mittel deutlich hinter dem Durchschnitt der OECD-Staaten. In anderen Ländern sind die Unterschiede also weit weniger deutlich, in Deutschland ist die Ungleichheit besonders groß.
Ein großer Teil dieser Ungleichheit hat allerdings nur bedingt mit der Zuwanderungsgeschichte in der Familie eines Kindes zu tun. In Deutschland ist der Einfluss von Armut und Wohlstand auf den Bildungserfolg noch immer sehr stark. Und zugewanderte Menschen sind überdurchschnittlich oft von Armut betroffen. Laut Mikrozensus leben 2019 etwa 12 Prozent der Minderjährigen ohne Migrationshintergrund in Familien, die von Armut gefährdet sind. Gleichaltrige mit Migrationshintergrund sind mehr als doppelt so häufig betroffen. Rund ein Drittel gilt als armutsgefährdet.
Wie schwer es dem deutschen Schulsystem fällt, solche Ungleichheiten aufzufangen, zeigt die OECD auf, indem sie alle PISA-Teilnehmenden in fünf gleich große Gruppen einteilt. Sie unterscheidet die Kinder dabei anhand ihres sozio-ökonomischen Status, also nach dem Einkommen, Beruf und Bildungsabschluss ihrer Eltern, nach der Anzahl der Bücher zu Hause oder auch den Möglichkeiten in Ruhe die Hausaufgaben zu machen. Die Kinder in der ersten der fünf Gruppen sind also besonders wohlhabend, die in der letzten besonders benachteiligt.
In Deutschland erzielen die Kinder in der ersten Gruppe sehr viel bessere PISA-Ergebnisse als alle anderen Gruppen. Sie liegen etwa gleichauf mit vergleichbar wohlhabenden Kindern in Estland. Ihr Abstand zu den Kindern in den anderen vier Gruppen aber ist so groß, dass die deutschen Kinder in der vierten Gruppe nur so erfolgreich sind, wie die am stärksten benachteiligten estnischen Kinder.
Nach dem neuerlichen PISA-Schock fordern viele Fachleute mehr Investitionen in das deutsche Bildungssystem. Deutschland liegt hier zwar deutlich unter dem OECD-Durchschnitt. Geld alleine in die Schulen zu pumpen, wird das Problem aber nicht lösen. Denn oft wird eine Stellschraube vergessen, die besonders wichtig wäre, um soziale Ungleichheiten abzufedern: die Betreuung und Bildung der Jüngsten.
Kindertagesstätten sind der Ort, an dem viele bildungstechnische Weichen gestellt werden - und chronisch unterbesetzt. Darunter leiden nicht nur viele Eltern, sondern vor allem frühkindliche Bildung und besonders die Chancen benachteiligter Kinder.
Trotzdem ist die Kita strukturell nicht dem Bildungsministerium zugeordnet, wird oft nur als Betreuungsort betrachtet. Das will Ministerin Stark-Watzinger ändern. Viele Staaten, die bei der PISA-Studie besser abschneiden, sind auch hier Vorbild.