Lehrer-Präsident Meidinger"Alle Kultusminister haben großen Fehler gemacht"
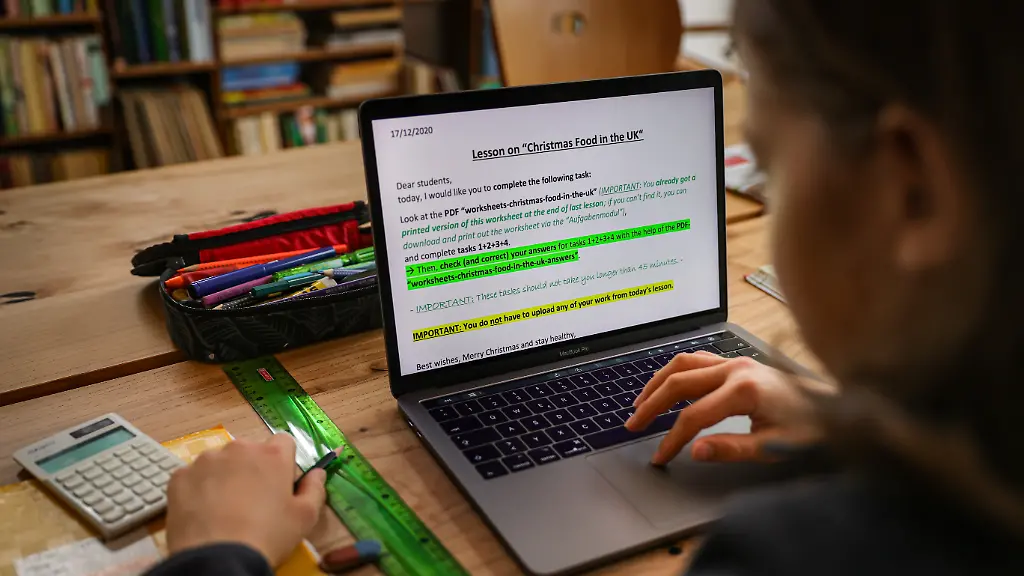
Der Deutsche Lehrerverband fordert von der neuen KMK-Präsidentin Britta Ernst, "endlich einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen in Kraft zu setzen". Den Ländern stellt Verbandspräsident Meidinger im Interview mit ntv.de ein schlechtes Zeugnis aus.
An diesem Montag spricht die Kultusministerkonferenz über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie. Der Deutsche Lehrerverband fordert von der neuen KMK-Präsidentin Britta Ernst, "endlich einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen in Kraft zu setzen", so Verbandspräsident Meidinger im Interview mit ntv.de. Die Behauptung der Kultusminister, Schulen seien von der Pandemie kaum betroffen, "lässt sich in keiner Weise mehr aufrechterhalten", betont Meidinger. Allen Bundesländern stellt er ein schlechtes Zeugnis aus: "Es gibt kein Bundesland, das man als leuchtendes Vorbild beim Umgang mit der Pandemie an Schulen hinstellen könnte."
ntv.de: An diesem Montag enden in sieben Bundesländern die Weihnachtsferien. Trotzdem sprechen die Kultusminister erst jetzt, am Montag, darüber, wie es weitergehen soll. Können Sie erklären, warum das Ende der Ferien für die Kultusministerinnen und -minister immer überraschend zu kommen scheint?
Heinz-Peter Meidinger: Alle Schulministerien haben leider bei Schuljahresbeginn im Herbst einen großen Fehler gemacht. Sie haben sich ausschließlich auf das Szenario des Präsenzunterrichts konzentriert und den Eindruck erweckt, dass es keinen neuerlichen Lockdown mit Auswirkungen auf die Schulen geben werde. Gleichzeitig wurde versäumt, die Schulen ausreichend auf Digitalunterricht und eine neue Phase des Distanzlernens vorzubereiten. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass nach wie vor nur ein Bruchteil der Mittel des Digitalpakts abgerufen wurde und es auch nach wie vor große Probleme bei den Lernplattformen gibt. Die Kultusministerinnen und -minister haben schlicht ihre Hausaufgaben im Sommer und Herbst nicht ordentlich erledigt.
Wäre es sinnvoll, einen bundesweiten Stufenplan zu beschließen, der Richtlinien vorsieht, was unter welchen Bedingungen passiert? Denn die aktuellen Inzidenzwerte mögen ja unterschiedlich sein, aber dass bei einem Inzidenzwert von 200 in dem einen Bundesland etwas anderes beschlossen wird als in einem anderen ist doch kaum nachzuvollziehen.
Wir leiden alle darunter, dass es die KMK bis heute nicht geschafft hat, einen Hygienestufenplan zu verabschieden, der klar regelt, wie der Schulbetrieb abhängig vom Inzidenzgeschehen zu organisieren ist. Dabei könnte man sich dabei auf eindeutige Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts stützen, das dafür präzise Richtwerte vorgegeben hat. In der Vergangenheit wurde so ein einheitlicher Hygienestufenplan mit dem Argument von der Politik abgelehnt, dass man an Schulen keine besonderen Maßnahmen ergreifen müsse, wenn steigende Infektionszahlen lediglich auf Corona-Ausbrüche in Altenheimen zurückzuführen seien.
Das hat sich als falsch herausgestellt.
Wir haben heute überall in Deutschland ein hohes Infektionsgeschehen, das sich quer durch alle Altersgruppen, alle Bundesländer und alle Bevölkerungsschichten zieht. Die Behauptung, Schulen seien von der Pandemie kaum betroffen, lässt sich in keiner Weise mehr aufrechterhalten. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Verbänden der Kinder- und Jugendärzte einen Appell an die Politik gerichtet, endlich Schulen durch zusätzliche Gesundheitsschutzmaßnahmen und einen verbindlichen Hygienestufenplan zu sicheren Orten zu machen, soweit das in Pandemiezeiten überhaupt möglich ist.
In dem Appell fordern Sie unter anderem auch, dass alle Unterrichtsräume und Lehrerzimmer belüftbar sein und dass die Sanitäranlagen in einen hygienisch einwandfreien Zustand versetzt werden müssen. Wie um alles in der Welt kann es sein, dass das nicht längst passiert ist?
Das Umweltbundesamt hat unmissverständlich erklärt, dass nicht ordentlich belüftbare Räume nicht für Unterrichtszwecke benutzt werden dürften. Wir vom Deutschen Lehrerverband warten bis heute darauf, dass die Schulträger und die vorgesetzten Dienstbehörden entsprechende Begehungen an allen 40.000 Schulen in Deutschland durchführen, um eindeutig zu klären, welche Räume ausreichend be- und entlüftet werden können und welche nicht. Bei der Nachrüstung von Sanitäranlagen und der Intensivierung von Reinigungszyklen wurden durchaus anerkennenswerte Anstrengungen unternommen. Aber natürlich kann man einen in 30 Jahren aufgelaufenen Sanierungsstau in Milliardenhöhe nicht innerhalb weniger Monate komplett auflösen.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Dezember in einer Regierungserklärung angekündigt, dass Lehrpläne angepasst und die Abschlussprüfungen falls nötig verschoben würden. Hat Bayern oder ein anderes Bundesland schon damit begonnen, die Prüfungsaufgaben zu entschlacken? Immerhin beginnt der diesjährige Abiturjahrgang schon in wenigen Monaten mit den schriftlichen Prüfungen.
Wir vom Deutschen Lehrerverband sind dafür, dass man bei der Frage der Schulöffnungen die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen vorrangig in den Blick nimmt.
Natürlich ist es unter Umständen erforderlich, auf nicht behandelten Unterrichtsstoff in den Prüfungen zu verzichten beziehungsweise schon fertig gestellte Prüfungsaufgaben nochmals zu überprüfen. Es gibt ja auch schon Bundesländer, die dieses Jahr gegebenenfalls keine Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool beim Abitur entnehmen wollen, um mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Abschlussprüfungen zu haben. Dabei müssen wir aber aufpassen, dass die Anforderungen zwischen den Bundesländern nicht noch weiter auseinanderklaffen, als sie es ohnehin schon tun. Das ist ein Problem der Bildungsgerechtigkeit.
Dass man Schülerinnen und Schülern in dieser außergewöhnlichen Situation, für die sie nicht verantwortlich sind, entgegenkommt, ist nachvollziehbar. Prüfungsanpassungen dürfen aber nicht dazu führen, dass die Qualität der Abschlüsse insgesamt sinkt, was dann beispielsweise beim Abitur Auswirkungen auf die Studierfähigkeit hätte. Mit einem minderwertigen Corona-Abschluss würden wir unseren Schulabsolventen einen Bärendienst erweisen.
Die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat gefordert, "dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben" und zwar ausdrücklich "unabhängig von den Inzidenzzahlen". Was halten Sie davon, wenn Schulpolitik sich über Inzidenzzahlen hinwegsetzen will?
Als Lehrkräfte wissen wir natürlich ganz genau, dass Präsenzunterricht auch durch den besten digitalen Fernunterricht nicht zu ersetzen ist. Ich glaube auch, dass beim von uns geforderten Hygienestufenplan eine Differenzierung nach Altersgruppen gerechtfertigt ist, weil kleinere Kinder nach den vorliegenden Studien weniger infektiös sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass es verantwortbar ist, Kitas und Grundschulen ohne Rücksicht auf Inzidenzwerte im Januar wieder im vollen Präsenzbetrieb zu öffnen, also ohne Abstandsregelungen. Es war ja der große Fehler im Bundesland Sachsen, dass man ohne Maskenpflicht und ohne Abstandsregelungen am vollständigen Präsenzunterricht solange festgehalten hat, bis die Infektionszahlen durch die Decke gingen und man dann als erstes Bundesland vor Weihnachten die Schulen vollständig dicht machen musste. Bei einem ans Inzidenzgeschehen angepassten Hygienestufenplan hätte man das wohl vermeiden können.
Die neue KMK-Präsidentin, Britta Ernst (SPD) aus Brandenburg, hat gesagt, die KMK sei grundsätzlich dafür, dass Schulen offen sind, weil alle Kinder das Recht auf Bildung und soziale Teilhabe hätten. Es müsse aber immer eine Gesamtabwägung mit dem Gesundheitsschutz geben. Klingt da ein Umdenken an?
Das hoffe ich ganz inständig. Wir müssen wieder die Balance finden zwischen dem Bildungsauftrag der Schule, dem Recht von Kindern auf Unterricht und dem Lebens- und Gesundheitsschutz aller Mitglieder der Schulfamilie - von Schülern, Lehrkräften und auch den Eltern zu Hause. Diese Balance ist durch die einseitige Fixierung der Politik auf das Offenhalten von Schulen um jeden Preis gefährdet worden. Wenn bei der neuen KMK-Präsidentin da ein Umdenken anklingt, werden wir sie vom Deutschen Lehrerverband dabei voll und ganz unterstützen. Wichtig wäre aber, da wiederhole ich mich, endlich einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen in Kraft zu setzen.
Spielt in den Überlegungen der Kultusminister eigentlich auch der Gesundheitsschutz der Lehrer eine Rolle?
Mich hat in den letzten Monaten geärgert, wenn einzelne Schulminister und -ministerinnen in verschiedenen Verlautbarungen den Eindruck erweckt haben, die Lehrerverbände und die Lehrkräfte dächten ängstlich nur an sich und ihre Gesundheit, während sie selbst die Belange der Kinder und Jugendlichen im Blick hätten. Das war nicht fair. Jede Lehrkraft würde lieber heute als morgen wieder alle ihre Schülerinnen und Schüler in Präsenz unterrichten. Dazu müssen aber die Voraussetzungen gegeben sein, was die Infektionszahlen anbetrifft und auch was den Gesundheitsschutz der Lehrkräfte angeht. Bis heute fehlen an den meisten Schulen Raumluftfilteranlagen, bis heute haben die Bundesländer den Lehrern keine ausreichende Anzahl an FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Und so wie es aussieht, werden auch bei den Impfungen die Lehrkräfte bis weit in die Jahresmitte hinein noch warten müssen, bis sie drankommen. Wir hätten uns gewünscht, dass zumindest Lehrkräfte über 60 eine höhere Impfpriorität erhalten als sie jetzt haben.
Sind die Corona-Fallzahlen an den Schulen, die seit November von den Bundesländern an die KMK gemeldet werden, zuverlässig?
Auch da hat es sehr lange gedauert, bis sich die Bundesländer dazu entschlossen haben, endlich mehr Transparenz in die Infektionslage an Schulen zu bringen und Angaben zu der Gesamtzahl infizierter Schüler und Lehrkräfte zu veröffentlichen oder auch zu den Quarantänezahlen. Allerdings waren diese Daten bis zuletzt lückenhaft. Die Datenerhebung umfasste häufig bei weitem nicht alle Schulen in einem Bundesland und einige Bundesländer meldeten gar keine Zahlen an die KMK.
Ich glaube nach wie vor, dass die erste Schätzung des Lehrerverbands im November von 300.000 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne näher an der Realität war als die später veröffentlichte Zahl der KMK von 199.932 erfassten Personen, auch wenn diese scheinbar präzise Zahl einen objektiveren Eindruck vermittelte.
Welches Bundesland geht Ihrer Ansicht nach am sachgerechtesten mit der Krise um?
Es gibt kein Bundesland, das man als leuchtendes Vorbild beim Umgang mit der Pandemie an Schulen hinstellen könnte. Manche Bundesländer wie etwa Bayern haben mehr Anstrengungen beim Gesundheitsschutz an Schulen unternommen als andere und auch zusätzlich Digitalisierungsprogramme aufgelegt, aber insgesamt war das Krisenmanagement überall eher suboptimal.
Sollten Schulleiter mehr entscheiden dürfen? Oder ist es problematisch, mehr Entscheidungen nach unten zu delegieren?
Da die Politik sehr lange gebraucht hat, um klare Fahrpläne für die Schulen im Umgang mit der Pandemie zu entwickeln, waren die Schulen lange Zeit auf sich allein gestellt. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist in dieser ersten Zeit des Lockdowns ab März des letzten Jahres unheimlich viel an Schulen passiert. Es gab einen regelrechten Digitalisierungsschub, schulinterne Lehrerfortbildungen fanden in großer Zahl statt, Schulleitungen entwickelten eigene Modelle für den Wechselunterricht. Es wurden selbstständig Möglichkeiten gesucht, den Infektionsschutz an der jeweiligen Schule zu verbessern.
Nicht immer stieß das auf die Zustimmung der Behörden.
Nachdem die offiziellen Lernplattformen oft schnell zusammenkrachten, wichen viele Schulen selbstständig auf kommerzielle Produkte aus, die zwar nicht immer den höchsten Datenschutz boten, dafür aber wenigstens zuverlässig funktionierten. Datenschutz ist zwar gerade an Schulen sehr wichtig, man muss aber in solchen Ausnahmesituationen auch mal Kompromisse schließen. Dass einige Landesdatenschutzbeauftragte dann anschließend solchen eigenständig handelnden Schulen und Lehrkräften mit Anzeigen und rechtlichen Konsequenzen drohten, halte ich für völlig unangemessen. Schulleitungen und Kollegien, die das Notwendige getan haben, um den Bildungsauftrag weiter wahrzunehmen, darf man daraus nicht einen Strick drehen.
Im Lockdown dürften einige Schüler eine Schulverweigerungshaltung entwickelt haben. Muss man nachhaltige Strategien ins Auge fassen, um hier breit gegenzusteuern?
Während des ersten Lockdowns haben wir tatsächlich eine relativ große Gruppe von Schülerinnen und Schülern kaum erreicht. Das waren neben Kindern, die zu Hause keine elterliche Unterstützung erhielten, insbesondere Jugendliche, die ohnehin wenig leistungsmotiviert waren und auch etwas ausgenutzt haben, dass während des Distanzlernens vielfach keine Leistungserhebungen und Tests stattfanden.
Es ist ganz wichtig, dass in einer neuerlichen Phase des Distanzlernens oder Wechselunterrichts sowohl von der Schule als auch von den Eltern aus auf einen klar strukturierten Tagesablauf Wert gelegt wird. Auch für das Homeschooling muss es klare verpflichtende Regeln geben, etwa eine Anwesenheitspflicht bei den Videokonferenzen und eine klare Erledigungspflicht bei Hausaufgaben.
Mit Heinz-Peter Meidinger sprach Hubertus Volmer