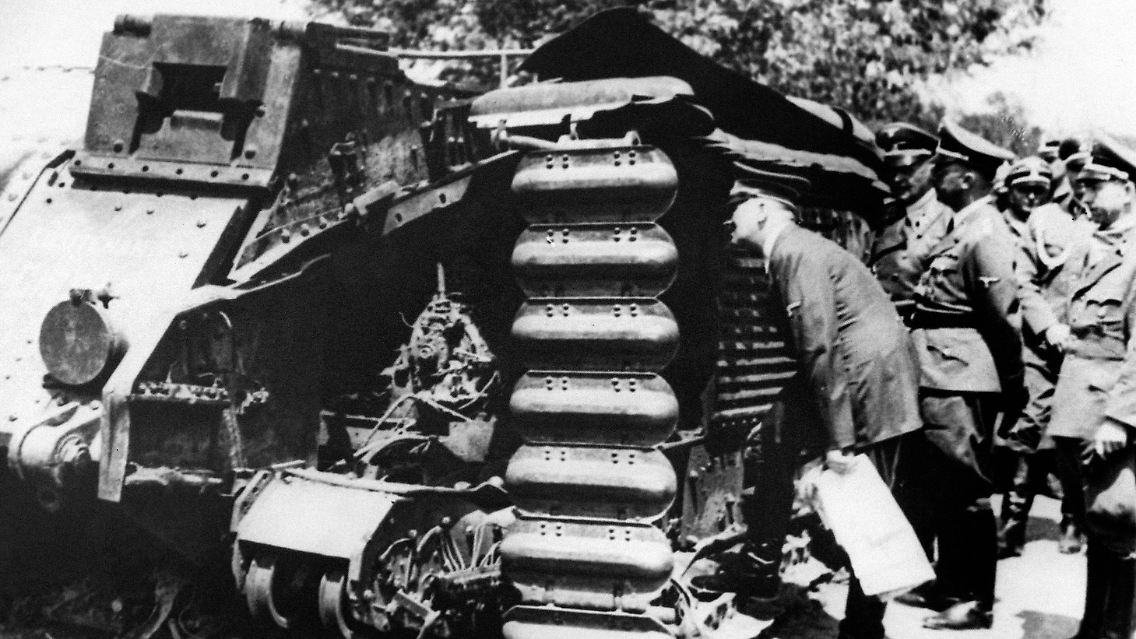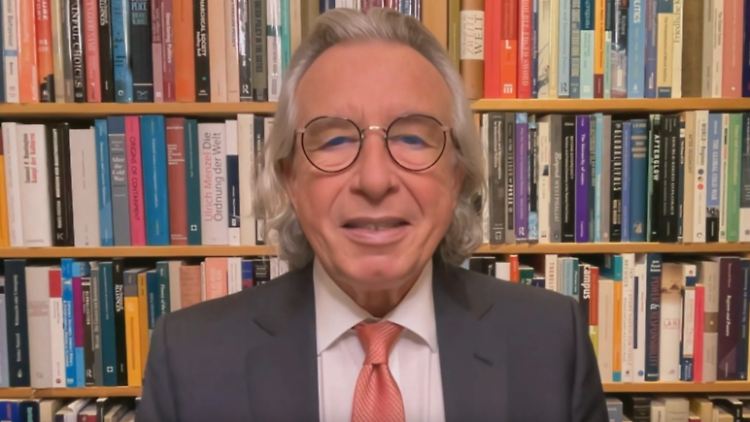"So endete der Krieg" Als Adenauer die Gefangenen heimholte
08.09.2015, 09:51 Uhr
Carlo Schmid, Nikita S. Chruschtschow, Walter Hallstein, Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger, Nikolai A. Bulganin, Georgij M. Malenkow, Wjatscheslaw Molotow am 8. September1955 in Moskau.
(Foto: dpa)
Es ist ein historischer Besuch: Vor 60 Jahren besucht Kanzler Adenauer Moskau und ringt dem kommunistischen Parteichef Chruschtschow ein Ehrenwort ab. Für Adenauer wird es einer seiner größten Erfolge.
Ein Foto zeigt still den Kummer. Es erzählt von der Sehnsucht von Familien, dass ihre Väter, Männer oder Söhne zehn Jahre nach Kriegsende noch am Leben sind und nun aus sowjetischer Gefangenschaft nach Hause kommen. Eine ältere Frau mit Dutt und Hut küsst Bundeskanzler Konrad Adenauer bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Köln/Bonn am 14. September 1955 die Hand. Adenauer steht kerzengerade, die Männer um ihn herum schauen gerührt.
Die deutsche Delegation war gerade aus Moskau gekommen, wo Adenauer einen seiner größten Erfolge erzielt hatte: die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der sowjetischen Regierung gegen die Zusage, dass die restlichen deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden. Nach dem Besuch Adenauers in Moskau vom 8. bis 14. September 1955 verließen nach russischen Angaben 39.628 deutsche Gefangene die Sowjetunion in Richtung BRD und DDR.
Die zu Hunderttausenden als Kriegsverbrecher Inhaftierten hatten jahrelang in St. Petersburg, Murmansk und vielen anderen von den Nationalsozialisten zerstörten Städten unter anderem Wohnhäuser für die Sowjetbürger gebaut. Adenauer verhandelte damals auf Einladung der sowjetischen Regierung mit Ministerpräsident Nikolai Bulganin und Parteichef Nikita Chruschtschow.
Wodka-Gelage in Moskau
Zum Jahrestag des Besuches erinnern russische Medien an die Wodka-Gelage mit der deutschen Delegation, deren Vertreter sich mit reichlich Olivenöl eine Grundlage für den Alkohol schafften. Adenauer habe aber nur Wein getrunken und den Russen unterstellt, Wasser statt Wodka in den Gläsern zu haben. "So endete der Krieg", schreibt das russischsprachige Magazin "The New Times" zum Jahrestag.
Bei der Bundestagswahl zwei Jahre später holte Adenauer die absolute Mehrheit und wurde zum dritten Mal Kanzler. Da war er 81 Jahre alt. Die Deutschen vertrauten seinem Kurs der Westbindung vor allem an Frankreich und die USA bei gleichzeitigem Kontakt zur Sowjetunion, um die Chancen auf die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands auszuloten.
Dass er keinen Schritt auf dem Weg zur deutschen Einheit weiterkam, ging im Jubel über die Freilassung der Gefangenen unter. Adenauers Verhandlungen in Moskau standen mehrfach auf der Kippe. Außer den schönen Bildern von einem Empfang mit 600 Gästen im prunkvollen Georgssaal im Kreml und von seinen Besuchen in einer Kirche und im legendären Bolschoi Theater drohte ihm eine Heimkehr mit leeren Händen. Am Ende gab ihm Chruschtschow zwar keine schriftliche Garantie, doch aber das Kreml-Ehrenwort für die Rückkehr der Gefangenen nach Deutschland, sobald die diplomatischen Beziehungen aufgenommen seien.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) schreibt dazu: "Niemand vermochte genau einzuschätzen, ob sich mit einem Botschafteraustausch die Möglichkeit zu bilateralen Verhandlungen über die Wiedervereinigung eröffnete, oder ob Moskau mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen letzten Endes nur die Zementierung der Zweistaatlichkeit Deutschlands intendierte." Es kam zur Zementierung, aber die Gefangenen kamen frei.
"Der Spiegel" schrieb damals, dass der Kanzler mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit während des Essens auf die Kriegsverurteilten zu sprechen gekommen sei. "Und urplötzlich hatte Bulganin gesagt: 'Gut! Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß acht Tage nach dem Entschluß, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, die Menschen heimkehren werden.' Er beugte sich über den Kanzler hinweg zum Genossen Chruschtschew: 'Nikita, was meinst du dazu?' - 'Ich gebe auch mein Ehrenwort.'"
"Vordenker einer Ost-West-Politik"
Lebenserfahrung und Menschenkenntnis hätten Adenauer geleitet, sich darauf einzulassen, erklärt die KAS. "Es war ein bahnbrechender Besuch, weil Adenauer und Chruschtschow eine Phase der Annäherung zwischen Deutschland und der Sowjetunion einleiteten. Sie sind die Vordenker einer Ost-West-Politik", sagt der Moskauer Deutschland-Experte Wladislaw Below.
Es sei auch für Chruschtschow, der nach dem Tod von Diktator Josef Stalin erst seit zwei Jahren an der Macht war, der wichtigste außenpolitische Schritt in schwierigen Zeiten gewesen, meint der Direktor des Zentrums für Deutschland-Forschung bei der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Die Sowjetunion habe Adenauers Besuch auch als Akzeptanz eines geteilten Deutschlands gewertet. Mit der DDR-Führung in Berlin hatte Moskau schon 1949 diplomatische Beziehungen aufgenommen.
Die "Welt" berichtete 2009, unter den Kriegsgefangenen seien viele ohne konkreten Vorwurf Inhaftierte gewesen, aber auch schwer belastete ehemalige Wehrmachtsoffiziere und sadistische SS-Männer. "Diese Folterknechte hätten in Sibirien bleiben können." Doch nicht alle Deutschen kamen in Freiheit. Der sowjetische Geheimdienst KGB verwehrte 27 Atomwissenschaftlern die Heimkehr, weil sie Geheimnisträger waren. Ihr Schicksal kennt, so schreibt die "The New Times", bis heute nur die Geheimdienstzentrale in Moskau.
Quelle: ntv.de, Kristina Dunz und Ulf Mauder, dpa