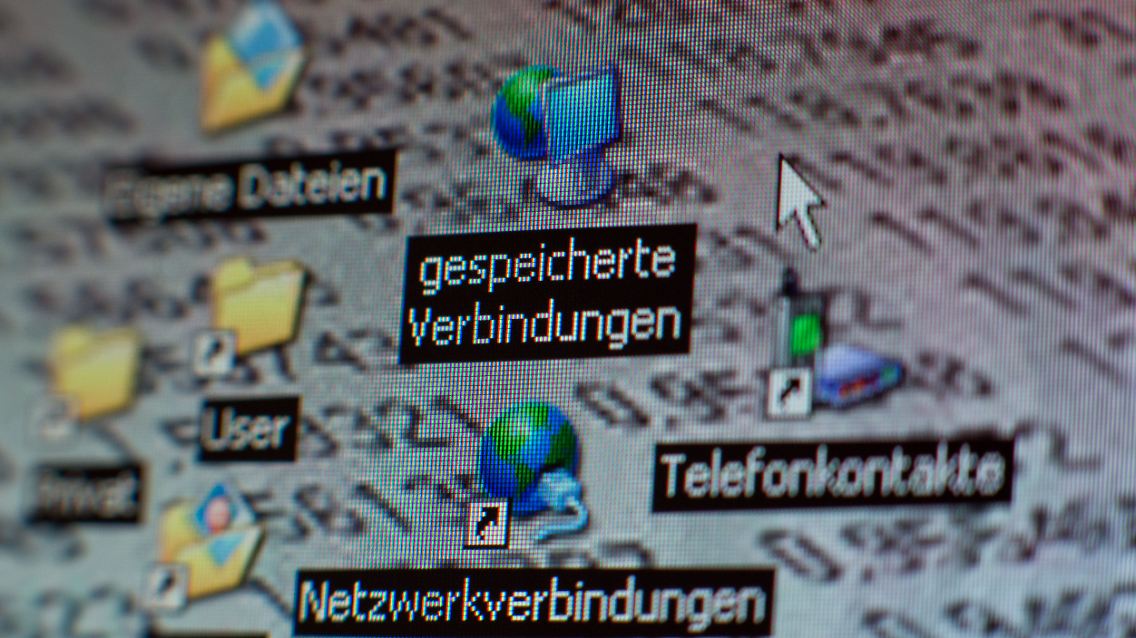Paris-Anschlag belebt alte Debatte Ist Vorratsdatenspeicherung nicht längst tot?
09.01.2015, 15:56 Uhr
Einige Sicherheits-Politiker wollen keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um islamistische Anschläge zu verhindern. Die Überwachung der Telekommunikation ist nur eines von vielen Mitteln. Im Bild zu sehen ist die Frau eines islamistischen Häftlings im Libanon.
(Foto: REUTERS)
Das Attentat auf "Charlie Hebdo" befeuert eine Diskussion, die längst beendet erschien: die über die Vorratsdatenspeicherung. Sicherheitspolitiker und Datenschützer streiten über ein Instrument, das womöglich schon überholt ist.
Plötzlich ertönen die Rufe wieder sehr laut: Die Vorratsdatenspeicherung sei ein unerlässliches Ermittlungsinstrument, heißt es von der CSU. "Der Anschlag von Paris unterstreicht hier die Dringlichkeit", sagt Innenminister Thomas de Maizière von der CDU. Aber Moment: War da nicht was?
Ja: Erst hat das Bundesverfassungsgericht die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten, die es in Deutschland zwischen 2007 und 2010 schon einmal gegeben hat, für verfassungswidrig erklärt. Im vergangenen Jahr folgte der Europäische Gerichtshof (EuGH) und kippte die entsprechende EU-Rechtlinie. Ist die Vorratsdatenspeicherung nicht längst tot?
Auch, wenn durch die höchstrichterlichen Urteile der Eindruck entstanden sein mag - tot ist das Ermittlungsinstrument noch nicht. Zumindest nicht ganz.
Tatsächlich gibt es über die Rufe der Union nach dem Angriff auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" hinaus Bestrebungen, die Vorratsdatenspeicherung in ganz Europa neu zu regeln. Medienberichten zufolge will EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos schon Mitte des Jahres einen Vorschlag für eine neue Richtlinie vorlegen. Klar ist allerdings: Die Grenzen einer solchen Regelung sind durch die Urteile aus Karlsruhe und Luxemburg sehr eng und der Nutzen einer möglichen Vorratsdatenspeicherung für die Straftatvermeidung entsprechend begrenzt.
Das Privatleben als Gegenstand ständiger Überwachung
Die Vorratsdatenspeicherung in ihrer ursprünglichen Form verpflichtete Telefonanbieter für einen festgelegten Zeitraum zu speichern, wer wem E-Mails geschrieben hat und wer mit wem am Telefon gesprochen hat. Auch die Dauer der Verbindung mussten Telefonanbieter festhalten. All das von allen Nutzern - unabhängig davon, ob ein Verdacht auf eine Straftat vorlag. Ermittlungsbehörden konnten dann bei Verdacht auf diese Daten zugreifen. In Deutschland galt diese Regelung bis März 2010.
Dann griff das Bundesverfassungsgericht ein, ließ alle gespeicherten Daten löschen und erklärte: Die Daten zu speichern sei zwar grundsätzlich zulässig. Sie abzurufen, um Straftaten zu verhindern, dürfen die Behörden aber nur dann, wenn es konkrete Hinweise auf eine Gefährdung für Leib und Leben gebe.
Der europäische Gerichtshof übernahm diese Sichtweise und forderte auch eine richterliche Genehmigung vor dem Datenzugriff. Ohne diese Einschränkung, so der EuGH, stehe der "besonders schwerwiegende Eingriff" in die Grundrechte der 500 Millionen Bürger der Europäischen Union schlicht in keinem Verhältnis zum Nutzen für die Sicherheitsbehörden. Schließlich gehe mit der Vorratsdatenspeicherung für viele Menschen das Gefühl einher, "dass ihr Privatleben Gegenstand einer ständigen Überwachung ist".
Kein Vergleich zu Prism und Tempora
Unabhängig von diesen Einschränkungen: Eine Superwaffe war die Vorratsdatenspeicherung nie. Auch mit den berüchtigten Spähmöglichkeiten des US-Auslandsgeheimdienstes NSA oder seinem britischen Pendant GCHQ war die Vorratsdatenspeicherung nie zu vergleichen. Bei Programmen wie Prism und Tempora geht es schließlich um eine Echtzeit-Überwachung der Kommunikation samt ihrer Inhalte und nicht nur der Verbindungsdaten. Das Stichwort heißt hier "Full Take". Zudem haben die US-Behörden direkten Zugriff, sie müssen nicht den Umweg über Telefonanbieter gehen.
Die Einschränkungen des Bundesverfassungsgerichts und des EuGH stutzen die vergleichsweise ohnehin beschränkten Möglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung weiter. Geheimdienste werden in der Regel schließlich sehr lange vor einer Tat aktiv. Den geforderten "konkreten" Verdacht vor dem Datenzugriff gibt es da oft noch nicht.
Der Anschlag auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" zeigt deutlich, was das bedeutet. Frankreich nutzt trotz des EuGH-Urteils weiterhin eine Form der Vorratsdatenspeicherung. Sie verhinderte aber nicht, dass die Brüder Kouachi zwölf Menschen töten konnten. Die gründliche Auswertung ihres Telekommunikationsverhaltens, die gerade im vollen Gange ist, könnte jetzt lediglich Hinweise auf Mittäter, Auftraggeber oder islamistische Netzwerke insgesamt geben. Das wiederum könnte - allerdings erst in Zukunft - Anschläge verhindern. Bei Einzeltätern, den so besonders gefürchteten "Einsamen Wölfen", oder bei isolierten Zellen nutzt sie in der Regel aber wohl nichts.
Ein Instrument von gestern
Einschränkend muss dazu gesagt werden: Belastbare Studien zur Effektivität der Vorratsdatenspeicherung gibt es bisher nicht. Noch sind Bewertungen ihrer Effektivität also eine Glaubensfrage. In der politischen Debatte werden dabei immer wieder Datenschutz und Sicherheitsbedenken gegeneinander ausgespielt - und das schon seit einem Jahrzehnt. Einer halben Ewigkeit also im digitalen Zeitalter. Auch jetzt gehen diese Fronten wieder auf: SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi reagierte prompt auf die Forderungen der Union und warnte vor "politischen Kurzschlusshandlungen". Die Grünen warfen CDU und CSU eine "Instrumentalisierung" der schrecklichen Ereignisse in Paris vor.
Einige Internetexperten bereichern diese alte Debatte um eine bisher wenig berücksichtigte Perspektive. Sie schließen zwar nicht aus, dass Sicherheitsbehörden mit der Vorratsdatenspeicherung zurzeit schlecht vorbereitete Kriminelle aufspüren könnten. Sie halten das Instrument in der Form, in der auch im Jahr 2015 über es gestritten wird, aber für lange veraltet. Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden dürften zumindest die etwas elaborierteren Anschlagsplaner, seien es nun die von Al Kaida oder die des Islamischen Staates (IS) aufgerüstet haben. Es ist schon lange möglich, zumindest die Verbindungsdaten im Netz zu verschleiern oder zu manipulieren. Der Cyber-Krieg-Experte Sandro Gaycken schrieb mit Blick auf Internetkriminelle deshalb schon vor einem Jahr in einem Gastbeitrag für das Magazin "Cicero": "Wir streiten uns über ein Mittel, das jetzt bereits zum Teil - bei seiner Einführung aber vermutlich endgültig - veraltet sein wird."
Quelle: ntv.de