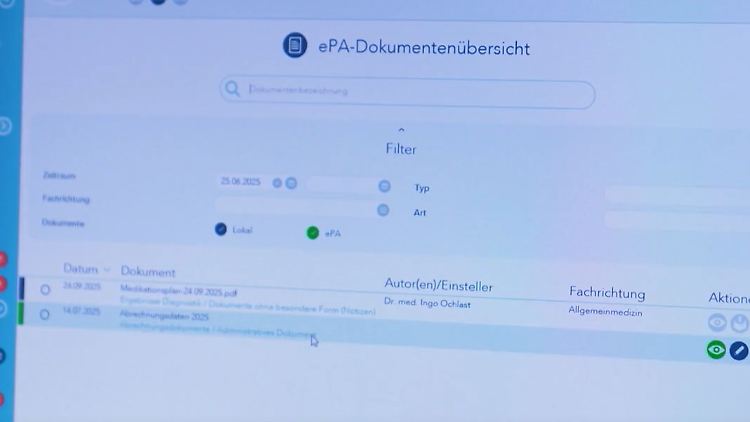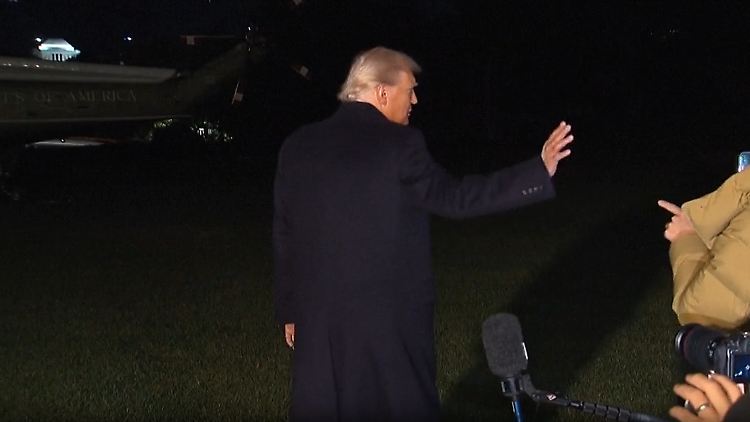Nach dem Parteitag der Grünen in Berlin Was man über ihr Programm wissen muss
28.04.2013, 18:51 Uhr
Die Parteichefs Claudia Roth und Cem Özdemir feiern sich und ihr Programm.
Die Grünen haben auf ihrem Parteitag ihr Wahlprogramm beschlossen - nach einem Abstimmungsmarathon. Zum Entwurf der Parteispitze lagen 2600 Änderungsanträge vor - ein Rekord. Worauf haben sich die Delegierten geeinigt? Welche Tendenzen zeichnen sich ab? Sind ihre Pläne umsetzbar? Die wichtigsten Dinge rund um die Pläne der Partei - in fünf Punkten.
Die Partei rückt nach links: Vor allem die Steuerpolitik der Grünen zeigt, dass sie eine großangelegte Umverteilung von Reich zu Arm planen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz von 42 auf 49 Prozent heben. Betroffen sind davon Bürger, die 80.000 Euro pro Jahr oder mehr verdienen. Beträgt das Jahreseinkommen eines Haushalts 60.000 Euro oder mehr, fallen 45 Prozent an. Die Grünen setzen zudem auf eine befristete Vermögensabgabe. Über zehn Jahre sollen Millionäre je 1,5 Prozent ihres Nettovermögens abgeben. Das Geld aus der Vermögensabgabe soll in die Schuldentilgung fließen. Die Mehreinnahmen aus den Steuererhöhungen sollen die öffentliche Infrastruktur stärken - unter anderem in Form eines besseren Kitaplatzangebots und besserer Bildung. Hinzu kommen ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde und gleiche Gehälter von Leiharbeitern und Stammbelegschaft vom ersten Tag des Arbeitsverhältnisses an. Auch eine garantierte Rente in Höhe von 850 Euro versprechen sie in ihrem Programm.
Die Grünen haben aus der Geschichte gelernt: Trotz ihrer weitreichenden Umverteilungspläne muss man die Entscheidungen der Delegierten als gemäßigt bezeichnen. Weitergehende Forderungen wie ein Spitzensteuersatz jenseits der 50-Prozent-Marke oder eine Vermögenssteuer in der nächsten Legislaturperiode lehnten die Grünen mit großen Mehrheiten ab. Zudem haben Realos und Linke laut dem bayrischen Landeschef Dieter Janecek einen Kompromiss ausgehandelt, nach dem eine Vermögenssteuer auch in fernerer Zukunft nur nach einer gründlichen Prüfung ihres Sinns Ziel sein darf. Wirklich radikale Forderungen, wie einst der Ruf nach fünf Mark für den Liter Benzin, sind heute bei den Grünen offensichtlich nicht mehr mehrheitsfähig. Die Partei setzt ihren Erfolg bei den Wählern nicht mehr mit Positionen aufs Spiel, die große Teile der Gesellschaft als extrem wahrnehmen. Sie will regieren und Regierungsfähigkeit demonstrieren. Das zeigt auch, dass die Delegierten den parteiübergreifenden Kompromiss mit Umweltminister Peter Altmaier (CDU) zur Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland mittrugen. Ein Gegenantrag, der das schon ausgehandelte Gesetz ablehnte, bekam keine Mehrheit.
Die Grünen machen ganz klar, mit wem sie regieren wollen: So deutlich wie mit diesem Wahlprogramm hat sich die Partei noch nie zu einem Wunschkoalitionspartner bekannt. In dem Text steht: "Wir kämpfen in diesem Bundestagswahlkampf für starke Grüne in einer Regierungskoalition mit der SPD, weil wir in diesem Regierungsbündnis die besten Chancen sehen, den Grünen Wandel umzusetzen." Ein weiteres Novum: Mit SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach erstmals ein Sozialdemokrat als Gastredner auf einer Bundesdelegiertenkonferenz. Er zählte zu den am heftigsten umjubelten Rednern.
Die Schwarz-Grün-Debatte bleibt der Partei trotzdem erhalten: Bekenntnis zur SPD hin oder her - über Koalitionen mit der Union werden die Grünen auch in Zukunft streiten. Denn die Partei schließt diese Option in ihrem Programm nicht ausdrücklich aus. Ihr Bekenntnis zur SPD begründet die Spitze wie schon seit Monaten mit den großen inhaltlichen Schnittmengen, die es derzeit (das ist das entscheidende) nur mit den Sozialdemokraten gibt. Grüne vom Realo-Flügel dürften die Auseinandersetzung über Schwarz-Grün darum immer wieder aufkeimen lassen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sagte: "Mich würde es wundern, wenn die Debatte nicht noch einmal aufkommt."
Mindesthaltbarkeitsdatum 22. September: Noch kurz vor dem Parteitag sagte der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, über eine Reihe von Zielen des Bundesvorstands: "Das ist nicht so leicht umgesetzt wie in ein Parteiprogramm geschrieben." Und damit hat er recht. Auch wenn die Grünen auf Extrempositionen verzichten, gibt es mehr als genug Vorhaben, die sie mit keinem Koalitionspartner umsetzen könnten - auch nicht mit der SPD. In der Sozial- und Steuerpolitik mögen die beiden Parteien sich noch einig sein. Spätestens beim Ausstieg aus der Kohlekraft ist aber Schluss. Die Grünen fordern, bis 2030 auf den Brennstoff als Energieträger zu verzichten. Mit der Zustimmung der Sozialdemokraten, die durch das Bergarbeitermilieu erst richtig groß geworden sind, ist in diesem Punkt nicht zu rechnen. Auch bei der Forderung, künftig auf den Einsatz von V-Leuten in der rechten Szene zu verzichten, stehen die Grünen ziemlich allein da.
Wirklich entscheidend ist bei der Frage, ob sich die Pläne der Grünen durchsetzen, aber noch ein anderer Punkt: Die Wähler müssen ihnen die Chance geben, ihre Ziele zu verwirklichen. Derzeit reicht es aber auch in der alleroptimistischsten Umfrage nicht für eine rot-grüne Mehrheit. Große Geste, mit nichts dahinter also? Man kann das auch anders sehen: Die Grünen haben noch Monate Zeit, und viele ihrer Forderungen kommen bei den Wählern an - sei es die Frauenquote (40 Prozent), der Mindestlohn (8,50 Euro) oder die Bändigung der Finanzmärkte (steigende Eigenkapitalquoten bei Banken und begrenzte Bonuszahlungen für Manager). Ihrem Image zuträglich dürfte zudem sein, dass die Grünen bereit sind, selbst Opfer für ihre Ziele zu bringen. Mehr als 70 Prozent der zu einem großen Teil wohlhabenden Anhänger der Partei würden einer repräsentativen Umfrage zufolge mehr Steuern zahlen, um Deutschland voranzubringen. Warum also nicht? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Grünen beweisen, dass sich mit Idealismus so manches in der Politik bewegen lässt.
Quelle: ntv.de