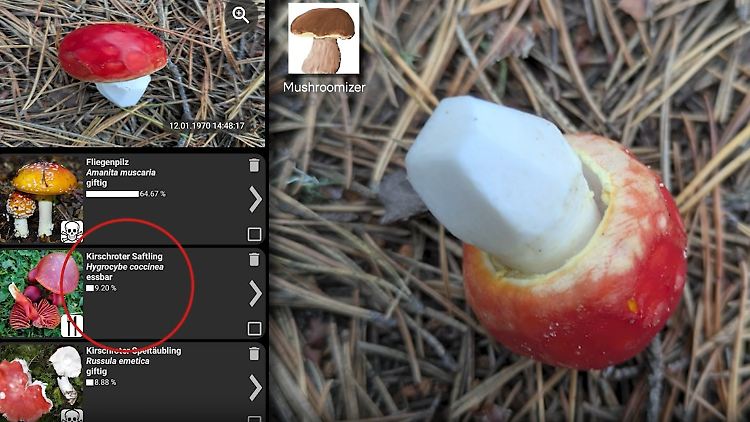Wohn-Riestern Die fast perfekte Eigenheimfalle
12.03.2008, 07:43 UhrBis einschließlich 2005 gab es in Deutschland die Eigenheimzulage. Wer gebaut oder eine gebrauchte Immobilie zur eigenen Nutzung gekauft hat, wurde vom Staat mit nicht geringen Geldgeschenken bedacht. Einzige Voraussetzung: Die positiven Einkünfte durften über zwei Jahre verteilt bei Ledigen 70.000 Euro, bei Verheirateten 140.000 Euro nicht übersteigen.
Als die Eigenheimzulage dann gestrichen wurde, verhallte der Aufschrei schon bald. Schließlich ist die Abschaffung von Subventionen grundsätzlich nichts Negatives. Die meisten haben die Eigenheimzulage inzwischen völlig aus ihren Gedanken gestrichen. Trotzdem hat sich die Bundesregierung entschlossen, sie unter anderem Namen durch die Hintertür wieder einzuführen.
Die Eigenheimzulage heißt jetzt Wohn-Riester. In gewisser Weise gibt es den Wohn-Riester zwar schon längst. Die Bedingungen wurden jetzt aber kundenfreundlicher gestaltet. Wer schon einen Riester-Vertrag sein eigenen nennt, kann das angesparte Kapital nebst Zulagen entnehmen und für den Kauf einer Immobilie einsetzen. Außerdem kann die kreditgebende Bank ein Förderkonto einrichten. Dies hat den Vorteil, dass alle Tilgungsleistungen wie fiktive Sparbeiträge auf einen Riester-Renten-Vertrag zählen. Wie bei anderen Riester-Verträgen auch beträgt die höchstens anrechenbare Summe 2100 Euro pro Jahr. Dadurch sichert man sich die staatliche Förderung (eigene Zulage und Kinderzulagen) oder man kann den Betrag von der Steuer absetzen.
Bumerang im Alter
Was sich zunächst gut liest, erweist sich im Rentenalter in vielen Fällen als Bumerang. Die erste Falle lauert im Vertragskonstrukt an sich. Natürlich darf ein normaler Riester-Sparer nicht schlechter gestellt werden als ein Wohn-Riester-Nutzer. Das Einkommen aus der Riester-Rente ist im Alter zu versteuern. Deshalb greift beim Wohn-Riester die nachgelagerte Besteuerung aller geförderten Spar- und Tilgungssummen. Die Steuerschuld kann auf einen Schlag oder verteilt auf einen Zeitraum von bis zu 23 Jahren gezahlt werden.
Bei der Zahlung auf einen Schlag verringert sich die Steuerschuld um 30 Prozent. Es muss also nur 70 Prozent des fiktiven Guthabens auf dem Wohnförderkonto versteuert werden. Allerdings kommt es durch die Einmalberechnung zu einem Progressionssprung, so dass für das zu versteuernde fiktive Guthaben ein deutlich höherer Steuersatz zu zahlen ist. Unterm Strich kommt man wohl unabhängig vom Berechnungsweg ungefähr auf die gleiche Gesamtsteuerlast.
Das prekäre an Situation ist allerdings, dass der Rentner oder die Rentnerin real kein oder nur wenig Geld aus einem Riester-Vertrag erhalten wird. Die Riester-Ersparnisse stecken schließlich fast ausschließlich in der Immobilie. Die anfallenden Steuern müssen daher aus der gesetzlichen Rente, anderen Rentenleistungen oder sonstigen Ersparnissen gezahlt werden. Bei der Kalkulation spielt das vorzeitige Ableben übrigens keine Rolle. Die noch ausstehenden Steuerschulden müssen dann die Erben begleichen.
Eigenheim kein Renditeobjekt
Doch es gibt noch ein weiteres Fettnäpfchen, in das die Wohn-Riesterer fast alle tappen werden. Die eigene Immobilie sorgt zwar oft für mehr Lebensqualität, als Anlageobjekt taugt sie aber fast nie. Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in Westdeutschland legte seit 1995 gerade einmal um sechs Prozent zu, im Osten fiel er sogar um 15 Prozent, ermittelte das Research-Unternehmen BulwienGesa. Bei Wohnungen fällt die Bilanz sogar noch schlechter aus: Kein Gewinn im Westen, 17 Prozent Verlust im Osten.
Selbst Wohnungen und Häuser in Städten wie Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und München sind keine Selbstläufer. Auch dort entscheiden noch weitere Faktoren wie Stadtteil und individuelle Lage über die Rentabilität. Übrigens: Die höchsten Wertsteigerungen im vergangenen Jahr erzielten laut BulwienGesa Schwerin, Zwickau und Magdeburg.
Als Investment sind da offene Immobilienfons wesentlich attraktiver. Diese investieren überwiegend in Bürogebäude und Einkaufszentren, deren Preise sich deutlich besser als bei Wohnungen und Einfamilienhäusern entwickeln. Zudem steht unterm Strich von Anfang an ein Guthaben und kein Schuldenberg, wie bei der Finanzierung der eigenen vier Wände. Eine absolut sichere Bank sind Immobilienfonds freilich auch nicht. Eine Durchschnittsrendite von 5,7 Prozent kann in einer Phase der konjunkturellen Verschlechterung kaum gehalten werden.
Quelle: ntv.de