USA vs. Megaupload Kimble im Knast, FBI offline
20.01.2012, 07:44 Uhr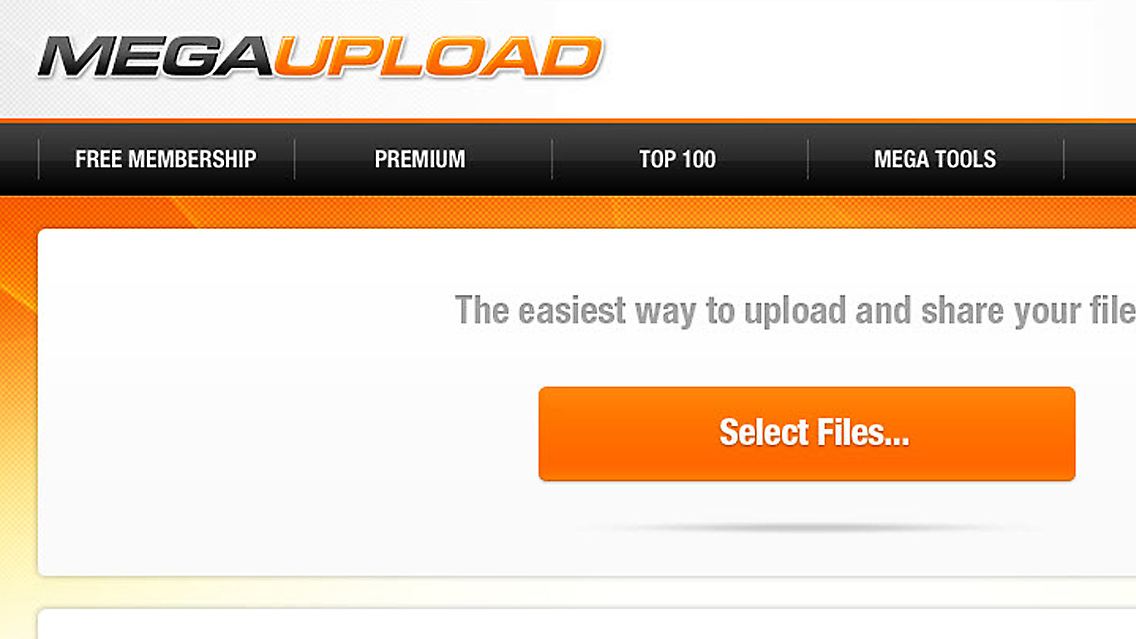
Die US-Behörden schließen die Tauschplattform Megaupload, in Neuseeland werden vier Verantwortliche der Seite festgenommen, darunter der einschlägig bekannte Kim Schmitz. Drei weitere Megaupload-Verantwortliche sind auf der Flucht. Anonymous reagiert mit Angriffen auf das FBI und die Musikindustrie.
Auf Betreiben der US-Justiz ist in Neuseeland der "deutsche Wirtschaftskriminelle und Hacker" (Wikipedia) Kim Schmitz festgenommen worden. Hintergrund ist der Streit um die Datentausch-Plattform Megaupload, hinter der Schmitz stehen soll.
Die Seite Megaupload.com wurde von der US-Justiz dicht gemacht. Die Netzaktivisten der Gruppe Anonymous reagierten mit einem Angriff auf die Webseiten des US-Bundespolizei FBI und des US-Justizministeriums, die daraufhin für Stunden lahmgelegt waren. Mittlerweile sind die Seiten wieder erreichbar. Die ebenfalls angegriffenen Seiten des Musikindustrie-Verbandes RIAA und des Marktführers Universal Music Group waren hingegen am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit noch immer offline.

Schmitz (r.) und seine drei Mithäftlinge. Fünf Sekunden Zeit gab der Richter den Fotografen für ihre Bilder.
(Foto: AP)
Der frühere Computer-Hacker Schmitz, der sich auch "Kim Dotcom", "Kimble" und "Kim Vestor" nannte, war in den 90er Jahren eine schillernde Figur der New Economy und machte mit ausschweifenden Partys von sich Reden. Nach dem Platzen der Internetblase wurde er 2002 vom Amtsgericht München wegen Insiderhandels mit Aktien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Zuletzt war der 37-Jährige laut US-Justiz in Neuseeland und in Hongkong gemeldet. Sprecher von Megaupload hatten stets erklärt, Schmitz sei zwar einer der Gründer, aber nicht im Tagesgeschäft aktiv. Das FBI, das ihn als "Dotcom" führt, nennt ihn dagegen die zentrale Figur von Megaupload.
Anwesen bei Auckland wird durchsucht
Schmitz' Millionen-Anwesen in Coateville nördlich von Auckland wurde von 70 Beamten der neuseeländischen Polizei durchsucht. Der Richter am zuständigen Gericht in Auckland lehnte eine Freilassung der Festgenommenen gegen Kaution ab. Am Montag sollen die vier erneut vor Gericht erscheinen.
Die USA haben die Auslieferung der Männer beantragt. Die neuseeländische Justiz selbst hat keine Anklage erhoben. Schmitz' Anwalt wollte zunächst verhindern, dass im Gerichtssaal gefilmt und fotografiert wird, wurde von seinem Mandaten jedoch zurückgepfiffen. Er habe nichts gegen Aufnahmen, machte Schmitz klar, "denn wir haben nichts zu verbergen".
Auf Schmitz' Anwesen wurden nach Angaben der neuseeländischen Polizei Wertgegenstände und Geld im Gesamtwert von sechs Millionen neuseeländischen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) sichergestellt. Darunter waren ein Rolls Royce Phantom sowie mehrere Gemälde. Bodyguards hätten den Beamten am frühen Morgen zunächst den Zutritt zu dem Anwesen verwehrt, teilte die Polizei mit. Auf dem Gelände seien auch zwei Gewehre sichergestellt worden.
"Mächtige Gegner"

Ein Schmitz-Bild aus dem Jahr 1999. "Kimble" hatte bereits damals einen gewissen Hang zur Inszenierung.
(Foto: Reuters)
Der "Spiegel" hatte bereits im Dezember geraunt, Schmitz habe "mächtige Gegner - und die haben ihn längst im Visier". Insgesamt klagte die US-Justiz sieben Männer an. Schmitz sei mit zwei anderen Deutschen und einem Niederländer in Neuseeland verhaftet worden, so das FBI.
Unter den drei Flüchtigen ist laut FBI ein weiterer Deutscher sowie ein Slowake und ein Este. Die Gruppe trage über Megaupload.com und ähnliche Seiten die Verantwortung "für massive weltweite Internetpiraterie von verschiedensten urheberrechtlich geschützten Werken". Mit illegalen Angeboten sollen sie mehr als 175 Million Dollar eingenommen haben.
Die Verdächtigen sollen im Netz Umschlagplätze für Raubkopien betrieben haben, durch die ein Schaden von über einer halben Milliarde Dollar entstanden sei. An den Ermittlungen seien auch das Bundeskriminalamt und die deutschen Justizbehörden beteiligt gewesen.
Größte Urheberrechtsklage der US-Geschichte
"Dies ist eine der größten kriminellen Urheberrechtsanklagen, die in den USA je erhoben worden ist", teilte das US-Justizministerium mit. "Es zielt auf den Missbrauch einer öffentlichen Speicher- und Verteilerplattform, um Verstöße gegen geistiges Eigentum zu begehen."
Schmitz und den Mitangeklagten drohen in den USA nun langjährige Haftstrafen. Alleine auf den Vorwurf der Verschwörung zu organisierter Kriminalität stehen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Außerdem werden den Männern Geldwäsche und Verstöße gegen das Urheberrecht zur Last gelegt.
Internetnutzer konnten auf Megaupload Dateien kostenlos hoch- und herunterladen. Die Anklage wirft den Betreibern vor, die Seite ausdrücklich als Tauschbörse für urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Musikstücke oder Filme eingerichtet zu haben. Megaupload sei nach eigener Darstellung rund 50 Millionen Mal täglich aufgerufen worden und habe mehr als 150 Millionen registrierte Benutzer gezählt, erklärte das Justizministerium in Washington.
Anonymous nimmt Rache für Schmitz
Über Twitter erklärte Anonymous, aus Rache für das Vorgehen gegen die Megaupload-Betreiber die Internetauftritte des US-Justizministeriums, des Musikkonzerns Universal sowie des Verbandes der US-Musikindustrie lahmgelegt zu haben. Anonymous dürfte dabei zu sogenannten DDOS-Attacken gegriffen haben, bei denen ein Web-Server mit Daten-Anfragen überhäuft wird, bis er unter dieser Last in die Knie geht.
Die Hackergruppe hatte in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Protestaktionen gestartet. An das FBI gerichtet schrieb Anonymous auf Twitter: "Fühlt ihr euch zensiert? Wir hoffen wirklich, dass ihr eure eigene Medizin mögt!"
Interessanter Zeitpunkt
Der Kampf gegen Raubkopien im Netz ist gerade ein heiß diskutiertes Thema in den USA. Gerade erst am Mittwoch gab es eine große Internet-Protestaktion gegen neue Gesetzespläne, die unter anderem die Sperrung von Webseiten erlauben sollen. Kritiker dieser Pläne warnen, dass damit eine Zensur-Infrastruktur geschaffen werde, die auch in anderen Fällen zum Einsatz kommen könnte. Aus Protest war unter anderem das englischsprachige Online-Lexikon Wikipedia einen Tag lang nicht erreichbar.
Insofern ist der Zeitpunkt Razzia der US-Behörden interessant - denn jetzt schlugen FBI und Justizministerium auch auf Grundlage der heutigen Gesetze erfolgreich zu. Sie werfen den Megaupload-Betreibern vor, die Verbreitung von Raubkopien unterstützt zu haben. Der Anklage zufolge sollen sie ihnen bekannte Raubkopierer für der Hochladen urheberrechtlich geschützter Inhalte bezahlt haben. Unklar ist, was mit den Daten gewöhnlicher Megaupload-Nutzer passiert, die dort ihre Dateien gelagert haben.
Quelle: ntv.de, hvo/AFP/dpa












