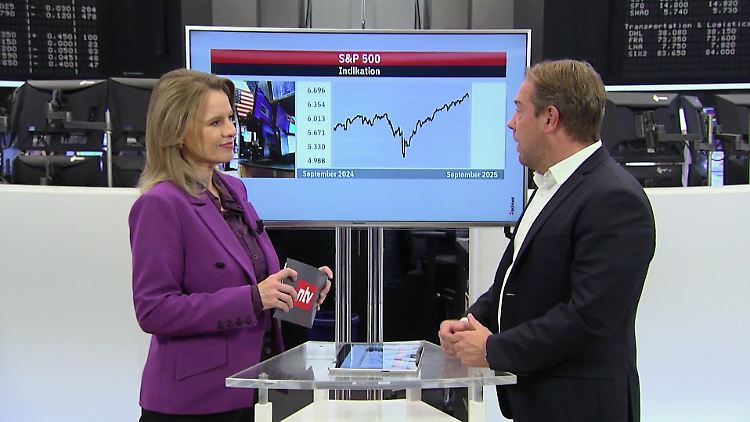"Größenwahnsinn", der sich auszahlt? VW klebt Toyota und GM an der Stoßstange
15.11.2013, 11:10 Uhr
Der weltgrößte Autobauer soll 2018 aus Deutschland kommen und VW heißen. Die Image-Probleme Toyotas und die Pleite von GM spielen dem Konzern dabei lange in die Karten. Doch die Konkurrenz gibt sich nicht kampflos geschlagen.
"Größenwahnsinnig", "unrealistisch", "anmaßend". Nicht wenige in der Autobranche rollten mit den Augen, als Martin Winterkorn kurz nach seinem Amtsantritt als VW-Chef im Jahr 2007 ankündigte, den Wolfsburger Konzern in eine "neue, höhere Umlaufbahn" bringen zu wollen. Das klare Ziel lautete: Wir wollen bis spätestens 2018 die weltweite Nummer eins der Branche werden.
Winterkorn brachte die Zweifler rasch zum Schweigen. Die Verkäufe stiegen rasant - dank der starken Stellung in Schwellenländern wie China und Brasilien. Dagegen schlitterten die Marktführer von einem Problem ins nächste: Opel-Mutter General Motors musste in der Wirtschaftskrise vom Staat vor der Pleite gerettet werden. Toyota ramponierte sich den Ruf durch klemmende Gaspedale und wurde später von der Erdbebenkatastrophe in Japan getroffen.
Spitze rückt enger zusammen
Doch die Aufholjagd von VW stockt. Die Marktschwäche in Europa und die Absatzprobleme in den USA bremsen den VW-Konzern. Jetzt kratzt auch noch ein millionenfacher Rückruf am Image. Nach jüngsten Berechnungen des Center of Automotive Management (CAM) aus Bergisch Gladbach dürfte Toyota das Kopf-an-Kopf-Rennen dieses Jahr mit 9,75 Millionen Autos ganz knapp vor GM mit 9,70 Millionen Wagen für sich entscheiden. VW bliebe mit rund 9,6 Millionen erneut Rang drei.
"Kollateralschäden" des Wachstums
"Wie die aktuelle Rückrufaktion zeigt, hat Wachstum auf Teufel komm raus seinen Preis", sagt n-tv.de-Autoexperte helmut Becker. "Wachstum läßt sich in so kurzer Zeit ohne 'Kollateralschäden' einfach nicht bewerkstelligen."
Stückzahlen sind nur die eine Seite der Medaille, weiß auch CAM-Chef Stefan Bratzel. Er prophezeit für die "ansonsten gut aufgestellten deutschen Hersteller sinkende Gewinne und Renditen". So schlägt das Problem des siechenden Heimatkontinents bei Volkswagen erheblich ins Kontor. Während Toyota über die ersten drei Quartale des Jahres mit 9,6 Prozent fast eine zweistellige Umsatzrendite schaffte, liegen die Wolfsburger mit 5,9 Prozent weit dahinter.
Problem: Ertragslage
Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen sieht das Problem vor allem bei der Massenmarke VW, wohingegen die Premiumschwestern Porsche und Audi "erheblich zum VW-Konzerngewinn beitragen". Toyota spiele bei der Ertragskraft schlicht in einer eigenen Liga, resümiert Dudenhöffer. Das habe zwei Gründe:
Zum einen sei Autobauen bei VW einfach teurer als beim Wettbewerb - und das trotz der viel beschworenen VW-Baukastenstrategie, die immer mehr identische Teile in verschiedene Modelle bringt. Zum zweiten habe der VW-Konzern deutlich höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten als Toyota. "Bei Toyota liegt der Anteil dieser Kosten am Umsatz bei 9,2 Prozent, im VW-Konzern bei 13,1 Prozent. Das sind Welten", sagt Dudenhöffer. Die hohen Vertriebskosten seien dabei auch Ausdruck hoher Rabatte, die VW einräumen müsse, um sich im Markt zu behaupten.
"Die Personalkosten bei Volkswagen sind auch heute noch zu hoch und die Produktivität zu niedrig", sagt auch Autoexperte Becker. "VW entwickelt, produziert, verkauft und verwaltet einfach zu üppig und komfortabel, während Weltmarktführer Toyota jegliche Verschwendung vermeidet."
"VW gewinnt derzeit eigentlich nur durch China", gibt Dudenhöffer zu bedenken. "In China werden aber die Wettbewerber stärker." So sei der Ford Focus im Oktober meistverkauftes Auto in dem Land gewesen. Ziehe man die guten Nachrichten aus China einmal ab, bleibe wenig. "Das Ziel von VW, bis 2018 Weltmarktführer zu werden, steht aus wackeligen Füßen", sagt Dudenhöffer und verweist auf die Margen.
VW setzt auf F&E
Das Margen-Problem haben auch die VW-Oberen erkannt. Der Vorstand schwenkt auf einen Sparkurs, will mehr denn je alles überprüfen. "Unser Fokus liegt auf einer konsequenten Kosten- und Investitionsdisziplin", gab Finanzchef Hans Dieter Pötsch jüngst die Losung aus. Kein Wunder, denn der Dax-Riese will spätestens 2018 nicht nur weltweit am meisten Autos verkaufen, sondern auch nachhaltig eine grundsolide Rendite von 8 Prozent schaffen.
Das dürfte nur mit Autos gelingen, die ohne groß mehr zu kosten, besser sind als die der Konkurrenz. Bei den Anschubinvestitionen für dieses Ziel macht VW jedoch so schnell keiner etwas vor: Europas Branchenprimus steckt so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie kein anderer Börsenkonzern der Welt. Das ergab jüngst eine Analyse der Beratung Booz & Company. Toyota und GM? Auf Rang sechs und elf. VW will nach eigenen Angaben bis 2015 mit den Töchtern wie Audi und Porsche 50 Milliarden Euro für Investitionen und Entwicklung ausgeben - und das Geld komplett aus dem eigenen Kerngeschäft erwirtschaften.
Schon einmal haben die Wolfsburger bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist. So verkaufte der VW-Konzern im ersten Amtsjahr von Winterkorn 2007 gerade einmal 6,2 Millionen Wagen. Das war gute Mittelklasse, aber keineswegs Weltspitze. Toyota und General Motors lagen meilenweit vorne mit jeweils fast 9,4 Millionen abgesetzten Wagen. Heute hängt Volkswagen den Rivalen direkt an der Stoßstange. Ob die Kraft auch zum Überholen langt, wird sich zeigen. "Viel hätte Winterkorn schon erreicht, wenn er nach dem Parforceritt der letzen Jahre die erreichte Position halten könnte. Denn der Wettbewerb schläft bekanntlich nicht", unterstreicht n-tv.de-Autoexperte Becker.
Quelle: ntv.de, bad/dpa