Studie zu Wähler-GefühlenAfD-Anhänger treibt die Angst um
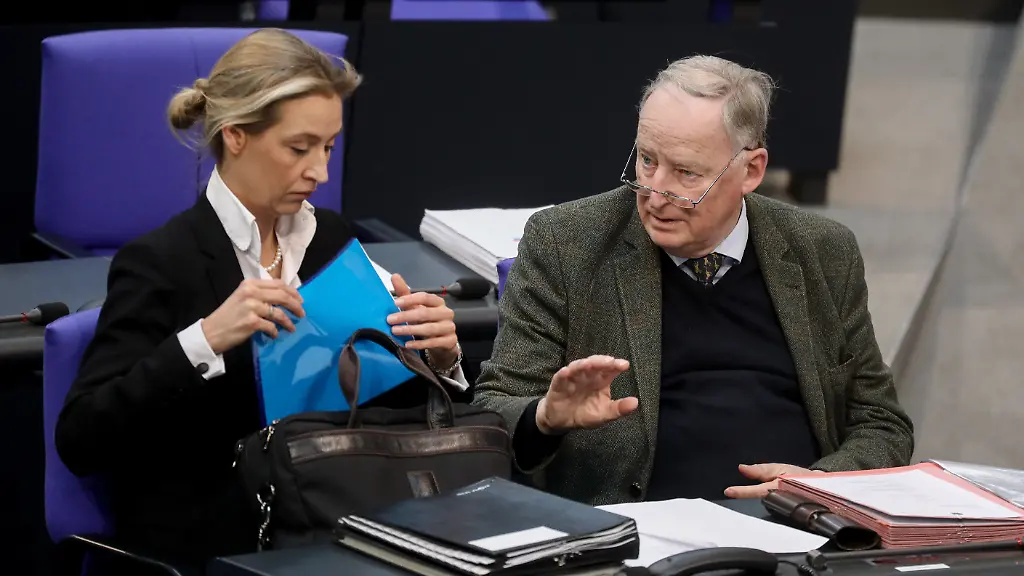
Die Unionsparteien wollen gerne Wähler von der AfD zurückholen. Das könnte jedoch schwierig werden. Eine Studie zeigt, wie unterschiedlich die Weltbilder von Anhängern der Rechtspopulisten und denen der Union sind.
Politik ist oft nüchtern, rational. Dabei sind es meist emotionale Faktoren, die Menschen dazu veranlassen, bei der einen oder eben der anderen Partei ihr Kreuz zu setzen. Von welchen Gefühlen die Anhänger verschiedener Parteien geleitet sind und welche Stimmungen die unterschiedlichen politischen Organisationen bei den Menschen in Deutschland wecken, hat die Konrad-Adenauer-Stiftung untersucht. Eine weit verbreitete These, nämlich, dass die Wähler von Union und AfD gar nicht so weit auseinanderlägen, widerlegt die Studie deutlich.
"Vor allem die Wähler der AfD, mit gewissem Abstand aber auch die Wähler der Linken, weisen Zukunftserwartungen auf, die stark durch negative Gefühle geprägt sind", heißt es in dem Papier, das auf drei repräsentativen Umfragen beruht. Wähler von Union und FDP blickten optimistisch in die Zukunft, die Wähler von SPD und Grünen stehen demnach zwischen den Lagern. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, heute Chef der CDU-nahen Adenauer-Stiftung, hält den Effekt emotionaler Zuwendung oder Abneigung in der Politik für "eher unterschätzt". Dabei gebe es gerade zwischen Union und AfD keine großen Schnittmengen. Wer sich im Umfeld der Union bewege, habe ein "deutlich anderes Weltbild" als Anhänger der AfD, sagte Lammert bei der Vorstellung der Studie.
Besonders ausgeprägt ist diese Kluft bei der Angst um die Zukunft des Landes. Während 85 Prozent der Anhänger der Union darauf vertrauen, dass Deutschland künftige Herausforderungen bewältigt, sind es bei der AfD nur 17 Prozent. 83 Prozent der Personen, die den Rechtspopulisten ihre Stimme geben würden, antworteten, dass sie für Deutschland "schwarz sehen, wenn das so weitergeht". Der überwiegende Teil der Anhänger von SPD (80 Prozent), Grünen (76 Prozent) und FDP (84 Prozent) blickt optimistisch in die Zukunft. Auch bei den Linken herrscht weitgehend Pessimismus: Nur 44 Prozent glauben an eine positive Entwicklung.
Bei der Frage, ob es angesichts der Entwicklung des Landes Grund zur Angst gebe, sind die Ergebnisse ebenfalls recht eindeutig – wenn auch der Unterschied zwischen AfD und den anderen Parteien weniger stark ist. 59 Prozent der AfD-Anhänger haben demnach "häufig Angst" vor dem, was kommen wird, bei den Linken 43 Prozent, bei den übrigen Parteien jeweils unter 40 Prozent.
Der Wunsch nach Veränderung ist ebenfalls bei AfD-Anhängern am stärksten ausgeprägt. 91 Prozent sind der Meinung, Deutschland müsse sich weiterentwickeln, sonst sei "Wohlstand in Gefahr". Auch bei den Wählern von Grünen, FDP und Linken vertreten jeweils mehr als 80 Prozent diese Meinung. Am "konservativsten", in dem Sinne, dass sie sich am wenigsten Veränderung wünschen, sind die Wähler der SPD – 75 Prozent der Sozialdemokraten glauben, dass es Veränderung brauche. "Der Wunsch nach Veränderung beeindruckt mich am meisten. Die Orientierung, am Status Quo festzuhalten, gibt es nicht", sagt Lammert zu den Ergebnissen. Das gilt nämlich auch für die Wähler der konservativen Unionsparteien: 81 Prozent von ihnen glauben, dass sich etwas ändern muss.
Gravierende Unterschiede gibt es auch bei der Frage, welche Gefühle mit den verschiedenen Parteien assoziiert werden. Von den insgesamt 1504 Befragten ordnete bei der AfD die überwiegende Mehrheit ihre Gefühle bei Begriffen wie Angst, Wut, Unbehagen und Empörung ein. Betrachtet man nur Anhänger der Partei, zeigt sich ein völlig anderes Bild: Es überwiegen Gefühle wie Sicherheit, Vertrauen, Zuversicht, Zufriedenheit und Hoffnung. Da die Autoren der Studie die Stimmungslagen in zwei verschiedenen Zeiträumen erfassten, lässt sich auch ein Trend ausmachen. Gefühle wie Stabilität und Hoffnung haben bei den AfD-Anhängern zwischen November 2017 und Februar 2018 zugenommen. Bei allen anderen stiegen angesichts der Partei Unbehagen und Angst.
Bei der krisengeplagten SPD nahmen zwischen Ende 2017 und Februar 2018 die Gefühle von Stabilität, Sicherheit und Zuversicht ab. Im Frühjahr gaben deutlich mehr Menschen an, mit der Partei einen Zustand der Verzweiflung zu verbinden. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der FDP. Wurden vor dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen noch Stabilität, Hoffnung und Zuversicht genannt, war das vorwiegende Gefühl im Frühjahr 2018 Gleichgültigkeit.