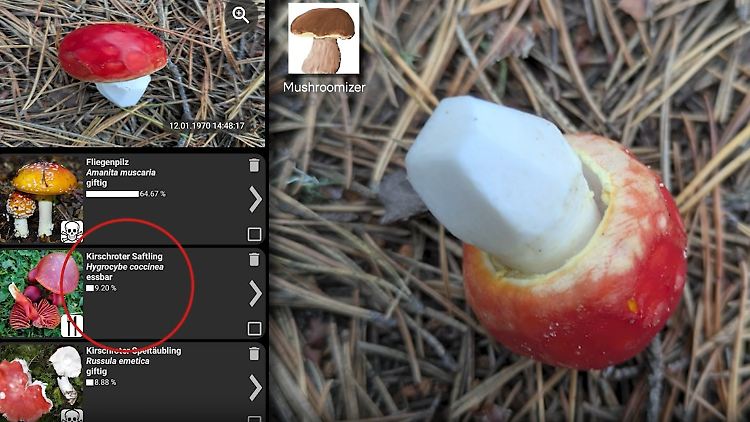Kopien von Musik und Film Was erlaubt, was verboten ist
17.03.2008, 08:48 UhrFast jeder zweite Haushalt in Deutschland hat einen Internetanschluss. Die immer leistungsfähigeren Anschlüsse werden nicht nur zum Surfen benutzt. Es wird geschätzt, dass ein Drittel des Datenverkehrs auf Dateiaustausch zurückgeht. Musik- und Filmindustrie wehren sich heftig gegen die Verbreitung geschützter Werke und strahlen in Kino und Fernsehen Werbung aus, die Raubkopierern fünf Jahre Haft androht. Wo aber beginnt die Raubkopie und sind Raubkopierer Verbrecher? Was darf kopiert werden und welche Strafen drohen tatsächlich?
Privatkopie über Rohlinge bezahlt
Das Kopieren zum privaten Gebrauch ist nach wie vor erlaubt. Als Privatkopien gelten nicht nur Sicherheitskopien von Software, sondern auch Duplikate von Musik-CDs, um sie im Auto zu hören oder sie an Freunde und Familie weiterzugeben. Wer glaubt diese Kopien seien kostenlos, liegt aber falsch. Denn das Vervielfältigen von urheberrechtlich geschützten Werken ist gebührenpflichtig. Diese Gebühren werden allerdings beim Kauf von Rohlingen, Brennern und Mp3-Playern bezahlt. Diese Pauschale betrug letztes Jahr knapp sechs Cent für einen CD-Rohling. Mit dem Kauf des Speichermediums wird also bereits jede private Vervielfältigung bezahlt.
Ist eine Musik-CD oder ein Film aber kopiergeschützt, ist es verboten diesen zu umgehen. Ein Aufkleber "kopiergeschützt" zählt noch nicht als Kopierschutz. Der Schutz muss auch eine technische Schranke darstellen.
Auch Download verboten
Tauschbörsen wie KaZaa, Emule und BitTorrent sind nicht verboten, ebenso wenig ihre Nutzung. Denn hier werden auch urheberrechtlich freie Musikstücke und Filme ausgetauscht. Wer aber geschützte Filme und Musik anbietet macht sich strafbar. Das ist vielen Nutzern bereits bewusst. Problematisch hierbei: bei Börsen wie BitTorrent kann man nicht nur runterladen. Wer zum Beispiel einen Film herunter lädt, stellt gleichzeitig die unfertigen Teile zur Verfügung, die er bereits geladen hat. Damit ist er auch ein Anbieter. Deshalb wird immer mehr auf Alternativen wie Rapidshare zurückgegriffen. Hier werden Dateien online zur Verfügung gestellt. Man lädt sie direkt von der Homepage herunter.
Doch auch das ist ausdrücklich verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Es handelt sich um Kopien von „unrechtmäßig online zum Download angebotenen“ Vorlagen. Unrechtmäßig sind Vorlagen, wenn sie urheberrechtlich geschützt sind. Wer also den neuesten James Bond herunter lädt, noch bevor dieser im Kino anläuft, kann davon ausgehen, dass das Angebot illegal ist. Auch der Download ist also verboten.
Der gelegentliche Nutzer von Tauschbörsen macht sich ebenso strafbar wie der kommerzielle Vermarkter von Raubkopien. Eine Bagatell-Klausel für geringfügige Verstöße gibt es nicht. Auch wenn Verfahren bei wenigen Verstößen wegen Überlastung der Justiz oft eingestellt werden.
Theoretisch Haft – meist Geldstrafen
Die Filmverleiher zeigen in ihrer Raubkopierer-sind-Verbrecher-Kampagne in Kinos und im Fernsehen Spots, die vor bis zu fünf Jahren Haft für Raubkopierer warnen. Tatsächlich ist dieses Höchstmaß noch nie verhängt worden und gilt nur für kommerzielle Kopierer, die unrechtmäßige Duplikate verkaufen.
Als Verbrechen werden rechtlich Straftaten eingestuft, die mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Eine solche Mindeststrafe gibt es für Urheberrechtsverletzungen nicht. Raubkopierer begehen also kein Verbrechen sondern lediglich ein Vergehen. Für Vergehen zum privaten Gebrauch drohen zwar Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Meist werden sie als minderschwer aber nur mit Geldstrafen geahndet oder man einigt sich außergerichtlich auf Ausgleichszahlungen und Unterlassung. Nur jedes fünfte von 1843 Verfahren im Jahr 2006 wurde mit einer Verurteilung abgeschlossen.
Durchschnittlich 3000 Euro Strafe
Die Höhe der Zahlung richtet sich nach dem Schaden, also dem Handelswert der geladenen Dateien und der wirtschaftlichen Situation des Raubkopierers. Durchschnittlich müssen 3000 Euro Schadensersatz gezahlt werden. Dabei werden nicht nur die kürzlich herunter geladenen Stücke berücksichtigt. Oftmals steht die Polizei unangemeldet vor der Tür und nimmt gleich den ganzen Rechner mit. Dann kann ganz in Ruhe erfasst werden welche illegalen Kopien sich auf der Festplatte befinden.
Aber auch wenn es gar nicht zu einer Verhandlung kommt, kann es teuer werden. Allein das Verbotsschreiben eines Anwaltes kostet bis zu 2000 Euro Gebühr. Wer den Internet-Anschluss mit anderen teilt oder seinen Kindern zur Verfügung stellt, sollte wachsam sein. Es haftet nämlich der Besitzer des Internet-Anschlusses.
Anbieten heißt noch mehr Risiko
Das Runterladen ist zwar genauso verboten wie das Anbieten von geschütztem Material. Das Risiko erwischt zu werden, ist beim Anbieten aber viel höher. Um gegen die illegale Verbreitung vorzugehen setzen die Inhaber der Lizenz- oder Urheberrechte von Filmen und Musik Suchprogramme ein. Damit wollen sie vor allem die illegalen Anbieter aufspüren.
Durchsucht werden Tauschbörsen und Internetseiten. Dabei erhalten sie allerdings nur die IP-Adresse des Internetnutzers. Anhand dieser Nummer kann jeder Nutzer vom Internet-Anbieter eindeutig identifiziert werden. Die Anbieter sind nicht immer bereit, die Daten ihrer Kunden preiszugeben. Oft tun sie dies erst, wenn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen den Internetnutzer vorliegt.
Das Risiko einer Anzeige steigt mit der Anzahl der angebotenen Dateien aber auch mit ihrer Popularität und Aktualität. Gesucht wird in den Suchmaschinen nach angebotenen Titeln: Wer bietet das aktuelle No Angels-Album an oder das von Tokio Hotel? Je öfter ein Nutzer mit derselben IP-Adresse auffällt, desto größer die Wahrscheinlichkeit angezeigt zu werden. Da diese Suche recht aufwendig ist, wird vor allem nach den Titeln gesucht bei denen die größten Verluste vermutet werden. Das sind besonders aktuelle oder populäre Titel. Wer neueste Kinofilme herunter lädt und damit bei den meisten Börsen auch anbietet gerät also schneller ins Netz der Ermittler als der Cineast, der Fritz Langs Metropolis lädt.
Quelle: ntv.de