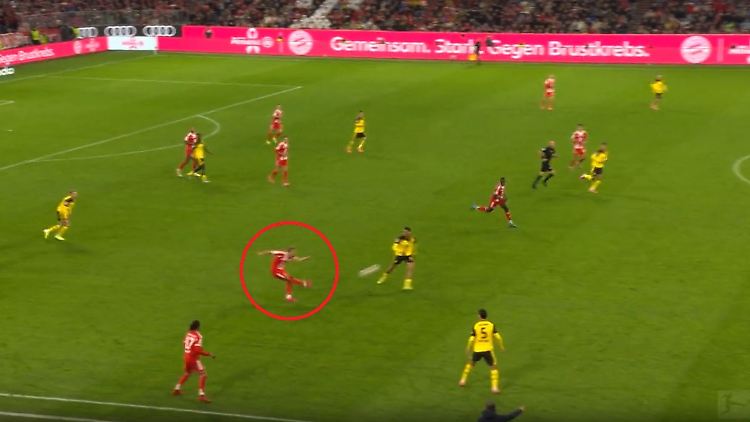Hartings Kritik geht zu weit Das IOC hat's verbockt, aber …
27.07.2016, 15:03 Uhr
Die Männerfreundschaft von Thomas Bach (l.) und Wladimir Putin wirft einen dunklen Schatten auf die IOC-Entscheidung.
(Foto: dpa)
Die Fifa, die Uefa, der DFB und jetzt das IOC. Die mächtigsten Männer im Weltsport machen derzeit nur selten eine gute Figur. So berechtigt Kritik an ihnen auch ist, so gefährlich ist die Enthemmtheit, mit der das geschieht.
Eine nüchterne Diskussion ist derzeit nicht mehr möglich. "Sperrt alle russischen Athleten für die Olympischen Spiele in Rio. Sie haben es nicht anders verdient. Der Staat hat viele von ihnen über Jahre mit allem möglichen, leistungssteigernden Zeug vollgepumpt. Sie haben den Sport verpfuscht. Systematisch." Das ist die eine Position. Man könnte sie Sippenhaft nennen. Die andere, sie kommt vornehmlich aus Moskau, lautet: "Pestet ihr mal nicht so rum, alle anderen dopen doch auch. Und zwar nicht nur heimlich, alleine, im dunklen Kellerloch." Eine durchaus zynische Art, von Chancengleichheit zu reden.
Das Problem: Für das illegale Leistungsförderungsprogramm der osteuropäischen Großmacht gibt es nun ausführlich Belege, aufgelistet im vor anderthalb Wochen veröffentlichten McLaren-Report. Für die gekonterten Alle-machen-das-Vorwürfe aus Russland dagegen nicht, zumindest nicht im großen Stil.
Weltweit wird gedopt. Daran gibt's keine Zweifel. Neu aber ist die Dimension. Sie führt die Sportgerechtigkeit endgültig ad absurdum. Doch wer glaubt, damit wäre der Tiefpunkt bereits erreicht, der irrt. Denn dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) sich nun beharrlich weigert, diese illegalen Praktiken wirklich zu bestrafen und russischen Athleten trotzdem heftiger Proteste von Anti-Doping-Kämpfern, ein Startrecht für die Spiele an der Copacabana einräumt, ist im besten Fall Schwäche. Im schlechtesten ein weiterer Beleg für Kumpanei und ein sich im Weltsport durchziehendes System von individueller Machtsicherung. Die Gentlemen-Agreement der Protagonisten: Manus manum lavat.
Macht, Geld, Nutzen
Ob das nun stimmt (wahrscheinlich), oder nicht (unwahrscheinlich) - geschenkt. Fakt ist: In den vergangenen Jahren führen die Entscheidungen der Sportgranden zu immer heftigerem Reaktionen: Olympische Winterspiele in der Küstenstadt Sotschi (2014, IOC), die Vergabe einer Fußball-WM ins klimatisch völlig ungeeignete Katar (2022, Fifa), Aufstockung der Fußball-EM in Frankreich (2016, Uefa), Sommermärchen-Affäre (2006, unter anderem DFB) und nun der peinliche Verantwortungsverzicht in der Russland-Frage (IOC). Wie es zu solchen Entscheidungen kommt? Es ist nicht nachvollziehbar – es sei denn man reduziert sie auf die Faktoren Macht, Geld und individuellen Nutzen.
Bei vielen Athleten, einigen Funktionären und allen Fans schafft das freilich ein ständig anschwellendes Frustpotenzial. Hat sich das zunächst in Kopfschütteln (Sotschi, Katar) entladen, war die nächste Stufe, erreicht nach den "Spiegel"-Enthüllungen um die Sommermärchen-Affäre im vergangenen Jahr, die totale Gleichgültigkeit. Beides war irgendwie zu ertragen, weil es das Diskussionsklima in einem akzeptablen, vielleicht manchmal sogar etwas zu kühlen Temperaturbereich hielt.
Das ist jetzt vorbei. Das IOC hat die rote Linie überschritten: mit ihrem fast wehleidigen Herumlavieren in der Frage, wie das russische Staatsdoping zu bestrafen ist und mit ihrer Entscheidung, die eigene Verantwortung auf die jeweiligen Fachverbände abzuwälzen. Im Zentrum der Kritik: IOC-Boss Thomas Bach, Kumpel von Kreml-Chef Wladimir Putin. "Erneute Mauschelei! Den guten Freund nicht verärgern? Besser nicht, ist ja schließlich ein mächtiger Typ!" So lauten die Vorwürfe.
Russische Medien feiern Thomas Bach
Und man mag sie leicht glauben. Denn die gemeinsamen Bilder der beiden Alphatiere sprechen für sich: Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Sotschi am 7. März 2014 saßen sie auf der Ehrentribüne des Olympiastadions, der Deutsche gab sich zunächst alle Mühe, distanziert zu wirken. Schließlich stand Putin wegen der wenige Tage zuvor angelaufenen Annexion der Krim international in der Schusslinie. Doch wenig später dann das: Beim Empfang im Anschluss an die Eröffnungsfeier, stoßen Bach und Putin lachend mit einem Glas Champagner an. Die damaligen Debatten über die extrem hohen Kosten für die Sportstätten in Sotschi oder das Anti-Homosexuellen-Gesetz? Sie schienen längst vergessen.
So etwas brennt sich selbstverständlich ein. An den moralischen Wertvorstellungen des höchsten Olympia-Vertreters lassen solche Bilder zumindest Zweifel aufkommen. Sie werden gar komplett in Frage gestellt, wenn Bach, der einst sagte, er nehme es als Kompliment, dass man ihn Russenversteher nenne, sich bei einer weitreichenden Entscheidung einer klaren Position verweigert. Dass selbst russische Medien die enge Männerfreundschaft als Schlüsselfaktor für das Rio-Startrecht anführen, verkürzt die Zündschnur der IOC-Kritiker erheblich – ob sie nun Robert Harting oder Claudia Pechstein heißen.
Dabei hätte es gar nicht so kompliziert sein müssen. Eine klare Ansage unter Männern hätte gereicht: "Lieber Wladimir, deine nachweislich sauberen Athleten dürfen nach Rio reisen. Aber wehe, einer fällt auf. Dann wir die ganze Bande gesperrt, alle gewonnenen Medaillen annulliert." Russland und dem Sport eine faire Chance gegeben, dennoch Härte gezeigt. Allen Kritikern wäre deutlich weniger Fläche gegeben worden, um sich an Bach abzuarbeiten. So wie's aber gekommen ist, musste es eskalieren.
Und dass es nun ausgerechnet Diskus-Werfer Harting war, den das unerträgliche Lavieren des Komitees der vergangenen Tage als ersten Profisportler öffentlich so richtig zur Explosion brachte, es überrascht nicht. Er steht im deutschen Sport wie kaum ein anderer für einen knallharten Anti-Doping-Kurs (den hatte er mit Bach übrigens bis kurz vor Veröffentlichung des McLaren-Reports gemeinsam) und für aggressiven Klartext. Dass er schwer enttäuscht von Bach sei, sich für ihn schäme, die Entscheidung einfach nur peinlich und auch das Startverbot gepaart mit einer Rio-Einladung für Whistleblowerin Julia Stepanowa absurd findet, all das darf er sagen, es ist ja sogar völlig berechtigt. Er trifft damit sicher auch den Nerv aller ehrlich Sportinteressierten.
Dass er Bach allerdings wörtlich – und ohne nachweisbare Fakten - als "Teil des Doping-Systems" beschimpft, ist gefährlich, selbst wenn er nur eine moralische Haftung meint. Harting enthemmt mit dieser Anschuldigung die Diskussion und verhärtet die Fronten. Das widerspricht aber genau dem, wofür er selbst kämpft: der Fairness.
Quelle: ntv.de