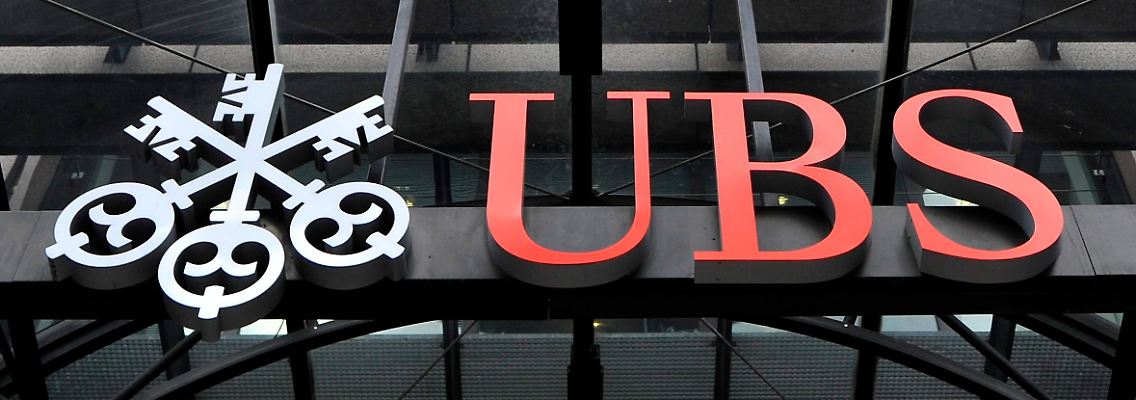Nicht mehr systemrelevant Commerzbank fliegt von der Liste
01.11.2012, 22:00 Uhr
Groß, aber nicht mehr groß genug, um das Weltfinanzsystem in den Abgrund zu reißen.
(Foto: REUTERS)
Für die zweitgrößte Bank Deutschlands ist es eine zweischneidige Entscheidung: Der Finanzstabilitätsrat erkennt der Commerzbank ihren Status als Geldhaus ersten Ranges ab. Damit dürfte das Haus zugleich auch verschärften Anforderungen an das Eigenkapital entgehen.
Die Commerzbank gilt international nicht mehr als systemrelevant. Der internationale Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board, FSB) strich das zweitgrößte deutsche Institut von der Liste der Geldhäuser, deren Zusammenbruch eine große Gefahr für die Stabilität der Weltwirtschaft bedeuten könnte.
Für die seit der Finanzkrise geschrumpfte Commerzbank bedeutet der Verlust des "Too-big-to-fail"-Status zwar einen Prestigeverlust. Sie spielt damit auch offiziell nicht mehr in der Top-Liga der Branche. Zugleich ist das aber eine große Erleichterung. Denn damit dürften künftig weniger strenge Anforderungen für sie gelten. Die als systemrelevant eingestuften Banken müssen voraussichtlich einen zusätzlichen Kapitalpuffer von bis zu 2,5 Prozent auf ihre Risikoposition aufbauen. Das Problem aus der Sicht der Banken: Eigenes Kapital bindet Geld und drückt auf die Gewinne.
Analysten warten auf die Strategie
Die Commerzbank hatte erst zu Jahresbeginn in einem schmerzhaften Prozess ihr Eigenkapital auf Geheiß der europäischen Bankenaufsicht kräftig steigern müssen. Als nicht mehr systemrelevante Bank dürfte nun der Druck zu weiteren Schritten geringer sein. Die Commerzbank gilt nun nur noch als "national systemrelevant" und dürfte deshalb nur von den deutschen und europäischen Aufsehern mit härteren Auflagen bedacht werden.
In der kommenden Woche will die Commerzbank ihre neue Strategie vorlegen, wie sie künftig angesichts niedriger Zinsen und eines radikal eingedampften Geschäfts Geld verdienen will. Erst im Sommer hatte das Institut angekündigt, sich komplett aus der zurückzuziehen. Auch die Staatsfinanzierung wird abgewickelt.
Insgesamt stuft der FSB noch 28 Banken als systemrelevant ein, bisher waren es 29. Nicht mehr dazu gehört die in der Abwicklung steckende belgisch-französische Bank und die britische . Neu hinzu gekommen sind die spanische und die britische . Einziges deutsches Institut auf der Liste der systemrelevanten Banken bleibt die .
Wie 'gefährlich' ist die Deutsche Bank?
Die Deutsche Bank zählen die FSB-Experten mittlerweile sogar zu den vier für das weltweite Finanzsystem gefährlichsten Instituten. Das geht aus der aktualisierten Liste der systemrelevanten Banken hervor, die der Finanzstabilitätsrat in Basel im Auftrag der G20-Staaten veröffentlichte. Der deutsche Branchenprimus müsste damit von 2016 an einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer von 2,5 Prozent aufbauen, so dass er 2019 auf eine Mindestausstattung von 9,5 Prozent Grundkapital und Gewinnrücklagen kommen müsste.
Zurzeit kommt die Deutsche Bank auf Grundlage der künftig geltenden Kriterien diesen Angaben zufolge auf weniger als sieben Prozent. Mit den Auflagen wollen die Aufseher verhindern, dass die größten Banken in einer Krise zusammenbrechen und auf Kosten der Steuerzahler gerettet werden müssen. In die gleiche, höchste Kategorie wurden die US-Institute und sowie die britische eingestuft. Zusammen mit der Deutschen Bank sind das vier Institute, die Investmentbanking und Privatkundengeschäft gleichzeitig betreiben.
Die Welt nach Lehman
Als Lehre aus der Finanzkrise müssen alle Großbanken in den kommenden Jahren ein Kapitalpolster von mindestens sieben Prozent ihrer Bilanzrisiken aufbauen, von den systemrelevanten Banken noch mehr. Der FSB veröffentlichte erstmals offiziell, in welche "Körbe" die jeweiligen Banken derzeit eingestuft würden. Damit will das Gremium unter dem Vorsitz des kanadischen Notenbankchefs Mark Carney einen Anreiz dafür schaffen, dass die Banken ihre Risiken reduzieren, um geringere Kapitalpuffer aufbauen zu müssen. Die Liste soll auch Thema beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs am Sonntag und Montag in Mexiko-Stadt sein.
Grundlage der "Systemrelevanz" sind Kriterien wie Größe und Vernetzung im internationalen Finanzsystem. Danach teilen die Aufseher die Banken in vier Gruppen ein, die unterschiedlich hohe Kapitalpolster vorhalten müssen. Barclays und BNP Paribas rangieren in der zweithöchsten Kategorie, in die Finanzkreisen zufolge vor einem Jahr auch noch die Deutsche Bank einsortiert worden war.
Reine Investmentbanken wie Goldman Sachs müssen nur 1,5 Prozent an zusätzlichem Kapital aufbringen. Das gilt auch für die Schweizer Großbanken und , die aber schon jetzt höhere Kapitalforderungen der Schweizer Finanzmarktaufsicht erfüllen müssen. Die HypoVereinsbank-Mutter liegt auf den hinteren Rängen (ein Prozent). Die Liste wird bis 2014 aktualisiert, die aktuelle Rangfolge basiert auf Daten von Ende 2011.
Bafin noch vor dem Wochenende
Doch die schärfere Regulierung von Großbanken beschränkt sich nicht auf mehr Kapital. Sie müssen auch ein "Testament" vorlegen, nach dem sie nach einem Zusammenbruch - möglichst unschädlich für das Finanzsystem - aufgespalten und notfalls zum Teil abgewickelt werden können.
Denn nicht nur Aufsehern und Politikern ist es ein Dorn im Auge, dass sich Banken in der Vergangenheit darauf verlassen konnten, auf Kosten des Steuerzahlers aufgefangen zu werden, weil sie zu wichtig für die Wirtschaft des Landes waren, um pleitegehen zu können ("too big to fail"). Neue Rettungsaktionen sind öffentlich kaum noch vertretbar. Doch in der Praxis schafft die Testamentsvorschrift Probleme - nicht zuletzt, weil die meisten Banken aus einer Vielzahl von Landesgesellschaften bestehen, die unterschiedlichen Aufsehern unterstehen. Der FSB sprach am Donnerstag von "ermutigenden Fortschritten".
Als eines der ersten Länder wird Deutschland von seinen größten Banken Sanierungs- und Abwicklungspläne einfordern. Die Finanzaufsicht BaFin will noch vor dem Wochenende veröffentlichen, was sie dazu konkret von den Banken erwartet.
Der Kreis der "national systemrelevanten" Banken ist deutlich größer: Bis zu einem Dutzend Institute könnten in diese Kategorie eingestuft werden, darunter auch die großen Landesbanken. Bei den Methoden, sie enger an die Kandare zu nehmen, haben die nationalen Aufseher allerdings mehr Spielraum als bei den Großbanken. Die Versicherungsaufseher der IAIS hatten im Oktober Pläne vorgelegt, nach denen auch große und damit systemrelevante Versicherer stärker beaufsichtigt werden sollen - vor allem da, wo sie sich außerhalb des angestammten Geschäfts tummeln.
Quelle: ntv.de, dpa/rts