E-Mobilität mit aller MachtWenn fördern, dann richtig
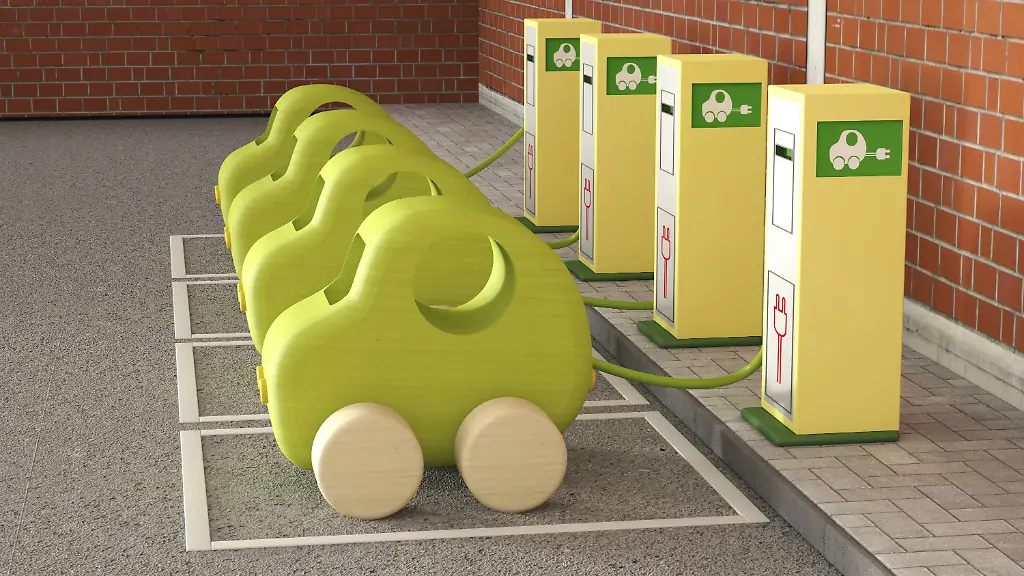
Elektroautos sind zwar umweltfreundlich leise und leider immer noch kostspielig. Nun greift der Staat ein und zahlt all jenen eine Prämie, die sich für ein Auto mit Akku entscheiden. Doch was muss der Staat und was sollte er?
Das Handwerk ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und Arbeitgeber in Deutschland. Manchen Betrieben geht es gut, anderen weniger. Käme man deshalb auf die Idee, sich beim Bäcker den Kauf eines Brotes staatlich fördern oder beim Friseur die neue Dauerwelle subventionieren zu lassen? Wohl kaum.
Die deutsche Automobilindustrie ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftszweig und großer Arbeitgeber. Manche Produkte laufen gut, andere weniger. Die Elektroautos zum Beispiel. Statt aber das illusorische Ziel zu kassieren, in vier Jahren eine Million stromgetriebene Pkw auf den Straßen haben zu wollen, wird jetzt die Förderung ihrer Anschaffung vorbereitet. Mag die Abwrackprämie noch einen Sinn gehabt haben, werden hier die falschen Schwerpunkte gesetzt.
Daseinsvorsorge statt Förderung
Die Aufgabe des Staates ist Daseinsvorsorge, nicht Förderung privaten Konsums. Schon gar nicht des Absatzes einer gerade gut verdienenden Industrie. Daseinsvorsorge wäre es, den Betrieb von Elektroautos zu erleichtern, nicht ihre Anschaffung. Mit dem Ausbau der Lade-Infrastruktur zum Beispiel. Klar, die Stromer sind teurer als konventionell angetriebene Pkw. Doch wenn es ein Problem mit Elektroautos gibt, dann ist es eines der Batterietechnik. Der Akku macht das Auto teuer und begrenzt die Reichweite. Mangelnder Aktionsradius ist der Hauptgrund für viele potenzielle Kunden, skeptisch gegenüber Elektromobilen zu sein. Ein dichteres Netz an öffentlichen Ladesäulen würde die Angst von Autofahrern mindern, mit leerer Batterie liegen zu bleiben.
Im vergangenen Jahr betrug der Anteil der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen für Klein- und Kompaktwagen in Deutschland mehr als 61 Prozent. In der Oberklasse waren es sogar über 80 Prozent. Das bedeutete in der Regel, dass sich ein etwaiger Mehrpreis des Fahrzeugs nicht in der aufzubringenden Anschaffungssumme niederschlug, sondern allenfalls in der monatlichen Leasing-Rate. Die obendrein noch als Betriebskosten von der Steuer abgesetzt werden kann.
Es fehlt an Lade-Möglichkeiten
Wenn schon Milliarden für die Subventionierung umweltverträglichen Individualverkehrs ausgegeben werden sollen, dann doch bitte so, dass ein Nutzen für die Allgemeinheit dabei heraus kommt. Für eine Million Euro könnte man etwa 150 Ladesäulen bauen. Die Neigung der vom Atomausstieg gebeutelten Stromkonzerne, dies mit Verve in Angriff zu nehmen, ist derzeit gering. Laut "Chargemap" gibt es gegenwärtig rund 30.000 Ladestationen hierzulande. Mit einer Milliarde könnte man diese Zahl versechsfachen.
Ein staatlich geförderter Ausbau der Lade-Infrastruktur würde nicht nur die Bereitschaft der Kunden unterstützen, über die Anschaffung eines Elektromobils nachzudenken, sondern auch den Schadstoffausstoß des Pkw-Verkehrs allgemein mindern. Fliegen und Klappe stünden in einem gesunden Verhältnis. Es gäbe eine reale Daseinsvorsorge für Mobilität und Gesundheit. Und wenn der Staat seiner Tätigkeit als Stromtankwart der Nation überdrüssig ist, könnte er sein Ladenetz immer noch an den Meistbietenden verkaufen.