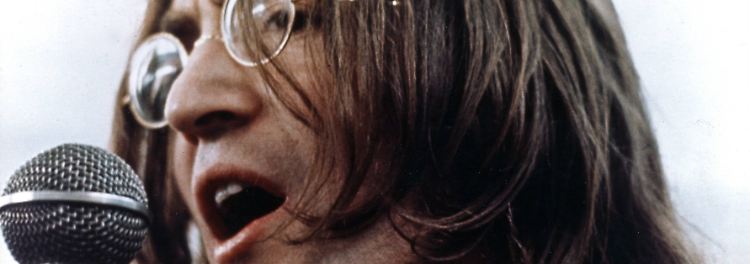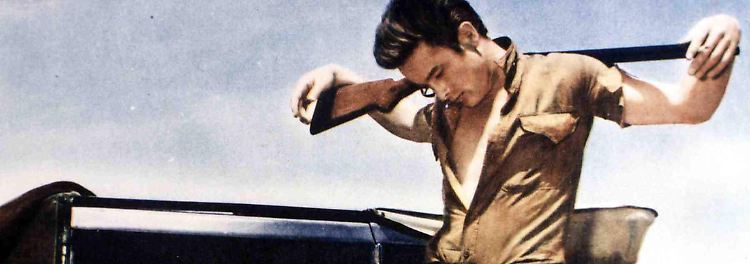Krank in den USA Moore polemisiert wieder
09.10.2007, 14:12 UhrVon Nona Schulte-Römer
Ein neuer Film von und mit Michael Moore, ein neuer Film, mit dem der umstrittene Propagandist und Entertainer seine amerikanischen Schwestern und Brüdern wachrütteln, zum Protest anstacheln und gut unterhalten will - allem Elend zum Trotz.
"Sicko" erzählt die schockierenden Krankengeschichten US-amerikanischer Bürger: Sie nähen ihre Wunden selbst, verzichten auf das Anflicken einer Fingerkuppe, weil die Operation zu teuer wäre. Sie müssen zusehen, wie ihren Kindern und Ehemännern im Krankenhaus die Behandlung verweigert wird, wie ihre Angehörigen sterben weil die Krankenkasse nicht zahlen will. Sie sind gezwungen, ihr Haus zu verkaufen und in die Rumpelkammer ihrer erwachsenen Kinder zu ziehen, weil Herzinfarkte und Krebsleiden ihr Versicherungsbudget sprengen. Andere wurden erst gar nicht versichert, weil sie von Versicherungen für zu dick oder zu dünn befunden wurden.
Die Bösen und die Guten
Diese Einzelschicksale, so erklärt der Filmkommentator im Ton eines Märchenerzählers, stehen für eine Vielzahl von betroffenen Kranken in den USA und für 18.000 Todesfälle jährlich. Die Toten könnten leben, hätten die medizinischen Gutachter der Krankenversicherungen die erforderlichen Behandlungen bewilligt, statt nur die Gewinnziele ihrer Unternehmen und ihre Karrieren zu pflegen.
In "Sicko" verlaufen die Fronten zwischen den Opfern und den Profiteuren des amerikanischen Gesundheitssystems. Moore nimmt den Zuschauer mit auf eine teils erschreckende, teils witzige Reise durch die Systeme. Dem bösen US-Modell stellt er die guten, menschenfreundlichen Gesundheitssysteme in Kanada, England, Frankreich und Kuba entgegen. Dort funktioniert die medizinische Versorgung nach dem Solidaritätsprinzip. Dort wird wirklich geholfen.
Mit den Mitteln des Films
Das kranke US-System bekämpft Moore mit allen Mitteln des Films: In pointierten Montagen wird der Traum vom "American Way of Life" lächerlich gemacht, ebenso wie die amerikanische Angst vor dem Sozialismus - schnell, sarkastisch und manchmal sogar selbstironisch. Moore spricht mit Patienten in Wartezimmern, mit Ärzten und US-Bürgern, die im Ausland leben und beide Seiten kennen.
Er selbst tritt erst unerwartet spät vor die Kamera und mimt in Gesprächen den unwissenden, vorurteilsbeladenen US-Amerikaner. Er trifft lachende Kanadier, verliebte Franzosen, unbesorgte Engländer und leidende Amerikaner.
Fassungslos hört er, dass ein englischer Arzt vom Staat so gut bezahlt wird, dass er sich eine ganze Londoner Wohnung und einen flotten Audi leisten kann. Als er französische Steuerzahler zu Hause besucht, ist er baff: Abgesehen von Hypothek und Fischfutter, scheint die Familie ihr Geld mit vollen Händen für Urlaub und französische Savoir vivre auszugeben. Als Moore in Paris erfährt, dass der französische Staat berufstätigen Müttern Haushaltshilfen zur Verfügung stellt, fällt er fast vom Stuhl.
Komplikationen unerwünscht
Für den Handlungsverlauf von "Sicko" spielt es keine Rolle, wie hoch die Steuern in Frankreich tatsächlich sind. Angesichts des katastrophalen US-Gesundheitssystems scheint es irrelevant, dass englische Patienten unter Umständen lange auf ein neues Hüftgelenk warten müssen, weil wichtigere Operationen Vorrang haben. Schade, dass Moore nicht auch Deutschland besucht hat. Durch seine gefärbte Brille hätten unsere unterfinanzierten Krankenhäuser, die Praxisgebühr und der Wust an Kassentarifen vielleicht in ebenso hellem Licht gestrahlt wie Kubas Apotheken und Kliniken.
Mit einer Kubareise setzt sich der Regisseur noch einmal groß in Szene - bei dem heroischen Versuch, einige, inzwischen lungenkranke und traumatisierte Rettungskräfte des 11. September in einem Boot zum Gefangenenlazarett in Guatanamo Bay zu schippern. Die Episode wirkt albern, trägt aber nicht unerheblich zum Spaßfaktor des Films bei und endet obendrein in solidarischer Gefühlsduselei: Ein kubanisches Krankenhaus nimmt die US-Helden auf, die kubanische Feuerwehr ehrt die Helden unter Tränen. Im Gegenzug profitiert Fidel Castro von einer Kuba-Promotionstour vor Millionenpublikum, für die er sich bei Moore bedanken sollte.
Einfach gestrickt, dafür umso unterhaltsamer
Die Realität in "Sicko" ist simpel, die Botschaft eindeutig: Solidarität und Demokratie gehören zusammen, denn "hoffnungslose Menschen wählen nicht". Kranke US-Bürger sind zu verängstigt, um gegen das System, in dem sie sterben, zu protestieren - Schnitt: ganz im Gegensatz zu den fröhlich protestierenden Franzosen. Muss man sich wundern, dass "Sicko" in Frankreich kein Kassenschlager wurde?
"Sicko" ist Dokutainment vom Feinsten und hat das Potenzial, auch ein deutsches Publikum zum Lachen und zum Weinen zu bringen. Gezeigt wird echtes US-amerikanisches Leid, Polemik und Schwarz-Weiß-Malerei la Michael Moore. Nebenbei erklärt "Sicko" im Rundumschlag die Welt. Moore scheint zwischen all den Leidensgeschichten absichtlich den Clown zu spielen.
Quelle: ntv.de