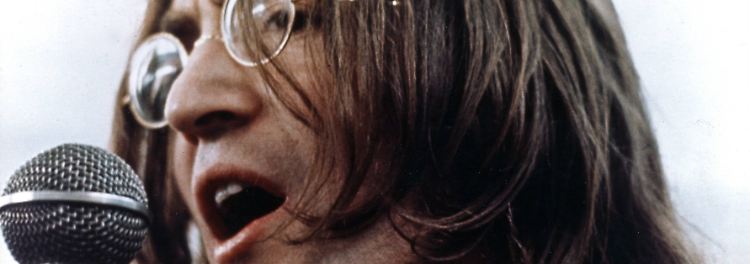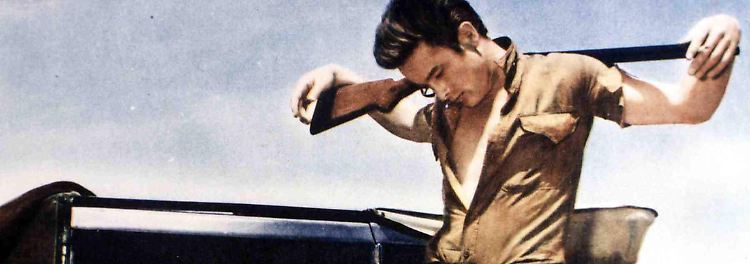Spielverderber Christentum Neuer Nicht-Glaube
27.03.2008, 11:35 UhrDer Atheismus hat neuerdings mit Aggressivität und Ironie ein besonders großes Lesepublikum erreicht. Außer Sachbüchern bietet auch das Internet inzwischen Plattformen, die sich dezidiert gegen Religion allgemein wenden. Ein Randphänomen ist hingegen die philosophisch-sachlich dargestellte und begründete Verneinung der Existenz Gottes geworden.
Ein Überblick über den "neuen Atheismus" in der von Jesuiten herausgegebenen Zeitschrift "Stimmen der Zeit" (München) beschreibt als Beispiel ausführlich den "kulturellen Atheismus". Das wichtige Phänomen werde vergleichsweise wenig beachtet, bedenkt man die Aufmerksamkeit, die der "denunziatorische Atheismus" der britischen Autoren Richard Dawkins ("Der Gotteswahn") und Christopher Hitchens ("Der Herr ist kein Hirte") fand.
Models ersetzen Jünger
Der deutsche Theologe Thomas Schärtl, seit 2006 an der Catholic University of America in Washington DC, schildert den kulturellen Atheismus als "ein Phänomen der Gegenwartskultur, das nichts weiter will, als das Christentum als kulturprägende Kraft zu vertreiben oder zu ersetzen." Erörternde Debatten sind dabei eher die Ausnahme.
Dieser Atheismus zeigt sich mehr in Teilen der belletristischen Literatur und den verschiedenen Formen der konsumistischen Gegenwartskultur, besonders deutlich in der Werbung. Der Autor nennt als Beispiel aus der europäischen Modebranche eine Grafik, die das berühmte Wandbild "Das Letzte Abendmahl" des Italieners Leonardo da Vinci (1452-1519) travestiert: Zwölf extrem modisch kostümierte und teilweise sehr aufreizend posierende Models umringen eine weibliche Zentralfigur, die Jesu Position einnimmt.
Der christliche Bezug des Gemäldes werde hier durch einen anderen Bezug ersetzt, schreibt Schärtl. "Aus dem Transzendenzbezug wird ein reiner, hedonistisch einzulösender Diesseitsbezug." Auch wenn solche Werbung schockieren und provozieren will, so werde doch unter der Hand auch ein Weltbild transportiert: Konsum statt Kommunion, sexuelle Selbstdarreichung statt Selbsthingabe, erotische Verschmelzung statt spirituell-mystische Vereinigung.
Der Autor verweist auch auf den französischen Philosophen Michel Onfray, der in seinen Schriften wie "Wir brauchen keinen Gott" für eine hedonistische Weltanschauung, für eine Philosophie des Gaumens und des Verkostens wirbt. Und der mit einer gewissen logischen Folgerung das Christentum als Spielverderber, Miesmacher und Lustkiller denunziert.
Nach Ansicht Schärtls fordert das Phänomen des kulturellen Atheismus zu einer neuen pointierten Klarstellung dessen heraus, was das Christentum ist und will. Dazu gehört: "Es ist solidarisch mit der verschwiegenen Geschichte all jener, die im sozialen Abseits stehen und die von den Gegenwartshedonismen unserer Tage systematisch ausgeblendet werden."
Spaß und Freude zutiefst heidnisch
Eine hedonistische Position wird auch in der 2004 gegründeten atheistisch orientierten Giordano Bruno Stiftung (GBS) vertreten. Ihr Vorstandssprecher, Michel Schmidt-Salomon, verwies kürzlich in einem Beitrag der Zeitschrift "Psychologie heute" (Weinheim) auf den Begriff "Heidenspaß". Er deute völlig zu Recht darauf hin, dass die konsequente Ausrichtung an Spaß und Freude eine zutiefst heidnische Lebenseinstellung sei.
Was Schmidt-Salomin vom Gottesglauben hält, formulierte er in einem von der GBS auszugweise dokumentierten Interview: "Ich definiere Gott als 'imaginäres Alphamännchen'. Wer überzeugend behaupten kann, er hätte einen besonders guten Draht zu diesem, erschleicht sich Vorteile in der menschlichen Säugetierhierarchie. Wir haben nun mal die Verhaltensneigungen von Primaten. Ein Bedürfnis ist aber kein Gottesbeweis."
Evolutionärer Humanismus
Er ist auch der Autor des Buchs "Manifest des evolutionären Humanismus - Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur". Der Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW, Berlin), Reinhard Hempelmann, ist der Auffassung: "Sollte das, was als 'evolutionärer Humanismus' bezeichnet wird, größere Resonanz und Akzeptanz finden, würde dies sicher ein wichtiges Thema für weltanschauliche Auseinandersetzungen sein und auch ein neues Aufgabengebiet für den Verfassungsschutz werden", wie er in der neuesten Ausgabe vom EZW-"Materialdienst" schreibt.
Jene "Leitkultur" stehe fraglos denjenigen Werten und ethischen Orientierungen entgegen, die dem Verständnis von Menschenwürde und Menschenrechten in der Verfassung zugrunde liegen. Er nennt dazu von Schmidt-Salomon formulierte Positionen. Darunter: Der evolutionäre Humanismus "spricht den Menschen nicht deshalb ethische Privilegien zu, weil sie 'Menschen' sind, sondern weil sie (zumindest in der Regel) 'Personen' sind."
Von Rudolf Grimm, dpa
Quelle: ntv.de