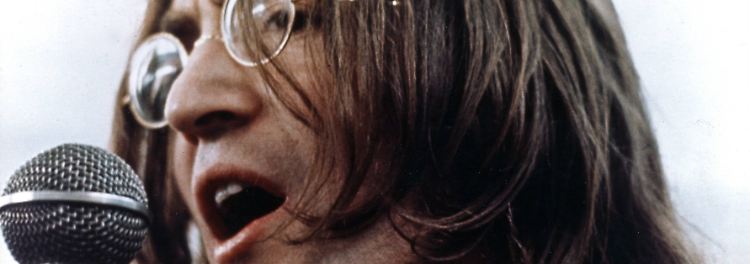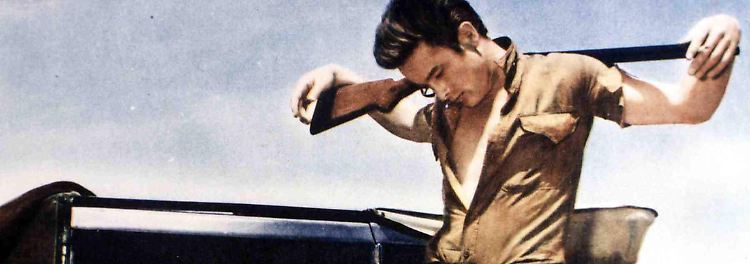Paul Simon wird 65 Legendär und gut gelaunt
08.10.2006, 11:32 Uhr"Ich bin kein Performer", hat Paul Simon einmal gesagt. "Ich bin ein Schriftsteller, der Platten macht." Beim Folk-Rock-Duo "Simon & Garfunkel" war er der Kopf, sein früherer Klassenkamerad aus Queens, Art Garfunkel, die Stimme.
Allerdings ist es immer wieder sein Zeitgenosse Bob Dylan, der für den Literatur-Nobelpreis ins Gespräch gebracht wird, nicht Paul Simon, der melancholische Schmerzensmann mit der Gitarre. Nach der Trennung von Garfunkel hatte der spröde Weltstar, der an diesem Freitag seinen 65. Geburtstag feiert, Erfolg mit Ethno-Pop.
Ein Rock-Rebell war Simon nie. Das sollten in den wilden 60er Jahren lieber Dylan, John Lennon und Co. übernehmen. Die Musik von Simon & Garfunkel nannten böse Kritiker stattdessen "Rock für Leute, die keinen Rock mögen". Aber spätestens seit Dustin Hoffmann in dem Film "Die Reifeprüfung" 1968 mit seinem rotem Alfa Romeo Spider zu den Klängen von "Mrs. Robinson" über den Highway düste, war klar, dass Simon & Garfunkel den Nerv der Zeit getroffen hatten. Die sensiblen, schwermütigen Texte von "Sounds Of Silence", "The Boxer", "Homeward Bound" und "I Am A Rock" begeisterten die linksliberale College-Generation. Simons Songs wurden zu Klassikern, die millionenfach verkauft wurden und zahlreiche andere Sänger inspirierten.
Aber gerade nach dem größten Erfolgsalbum "Bridge Over Troubled Water" (1970), dessen Titelsong - eine Ode auf Werden und Vergehen - bis heute als Popmeisterwerk gilt, trennten sich die Weg der beiden Jungen aus der jüdischen Mittelklasse. Garfunkel wollte sein Glück in Hollywood versuchen und Simon lieber musikalisch herumexperimentieren. Er wurde Kritikern zufolge zum "Klanglandschaftsgärtner", der es nie aufgegeben hat, an der Idee des perfekten Popsongs zu arbeiten.
Dabei hat er sich ungewollt viel Ärger eingehandelt. Sein Afro-Pop-Album "Graceland" (1986) war eine gelungene Kombination von amerikanischen und afrikanischen Rhythmen. Aber er musste sich anhören, er habe die beteiligten Musiker von Ladysmith Black Mambazo ausgebeutet und die Kultur des Kontinents geplündert. Wegen des damals international geltenden Kulturboykotts gegenüber dem Apartheidstaat landete Simon auf der "Schwarzen Liste" des Afrikanischen Nationalkongress (ANC) und der UNO. Er gewann trotzdem einen Grammy für "Graceland", das sich vier Millionen Mal verkaufte.
Seine nächste LP "The Rhythm of the Saints" (1990) wurde ebenfalls ein "Weltmusik"-Projekt, unter anderem mit brasilianischen Trommelrhythmen zu westafrikanischen Gitarrenklängen und Elementen ghanaischer "Palmweinmusik". 1997 kam das Konzeptalbum "Songs From A Capeman" auf den Markt, eine Mischung aus Salsa, karibischer Musik, Doo-Wop, Gospel und Rock. Das passende Musical "The Capeman" am New Yorker Broadway über das Schicksal des Puertoricaners Salvator Argon, der als Jugendlicher 1959 in den USA wegen Mordes verurteilt wurde, floppte allerdings und kostete Simon Nerven und Millionen seines eigenen Vermögens.
Der unauffällige, kleine Mann mit dem heute lichten Haar macht trotzdem weiter Musik. Im Mai erst erschien "Surprise", das der Vorzeige-Pop-Avantgardist Brian Eno produziert hat. Die Kritiken waren überrascht, sensationell verkauft hat sich das Album nicht. Dass er bei MTV nicht mehr mithalten kann, macht Simon nichts aus. Schließlich hat das Rentenalter auch sein Gutes: "Ich gelte jetzt angeblich als legendär, das heißt, ich verkaufe zwar weniger Platten, aber ich bin viel besser gelaunt als früher", sagte er in einem Interview.
(Carla S. Reissman, dpa)
Quelle: ntv.de