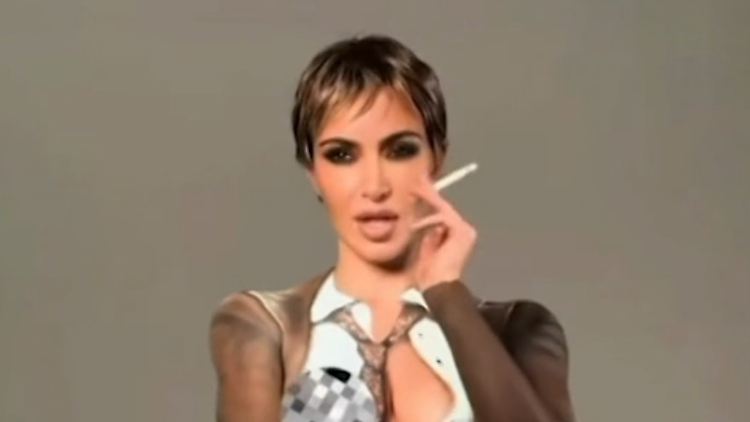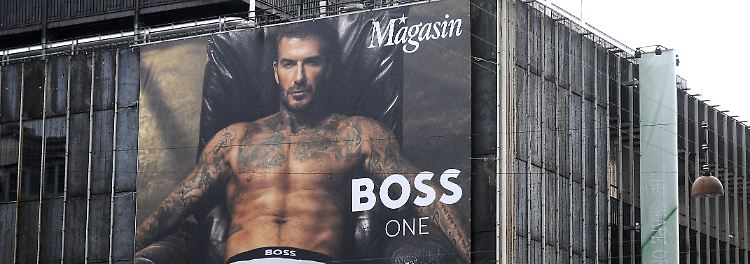Roma in der Sackgasse der Armut Zwischen Vorurteil und Realität
24.10.2012, 13:35 Uhr
In der bulgarischen Stadt Maglizh wurden im September mehr als 30 illegal errichtete Häuser von Roma-Familien abgerissen.
(Foto: REUTERS)
Sieben Jahrzehnte hat es gedauert, bis Deutschland ein Denkmal für die 500.000 von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma errichtet. Die Verfolgung der "Zigeuner" galt lange als Exzess in einer im Prinzip verdienten Behandlung. Auch heute noch sind Vorurteile gegen Roma tief verwurzelt.

Das Denkmal des israelischen Bildhauers Dani Karavan besteht aus einem zwölf Meter breiten Wasserbecken, in dessen Mitte sich eine Vertiefung befindet. In der Beckenmitte ist ein nach unten versenkbarer Stein angebracht, auf dem jeden Tag eine frische Blüte liegen soll.
(Foto: AP)
Beinahe wäre das Denkmal für die Menschen, die von den Nazis als "Zigeuner" verfolgt und ermordet wurden, an dem Wort "Zigeuner" gescheitert. Nun heißt es auf der Tafel an dem Denkmal, Sinti und Roma seien von den Nationalsozialisten "als Zigeuner" verfolgt worden.
Die Nationalsozialisten hatten 1943 "Zigeunermischlinge, Rom-Zigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft" in KZs schaffen und systematisch umbringen lassen. Sie bedienten sich dabei des damals üblichen Begriffs, der allerdings längst als diskriminierend gilt.
Seit den 1970er Jahren hat sich der Begriff "Sinti und Roma" durchgesetzt, Sinti für die in Mittel- und Westeuropa, Roma für die in Osteuropa lebenden Gruppen. Roma gilt als Sammelbegriff für die gesamte Minderheit. Seit 1995 genießen die Roma als nationale Minderheiten einen besonderen Status, zehn bis zwölf Millionen von ihnen leben in Europa. An dem Blick auf die Volksgruppe haben die Bemühungen um weniger diskriminierende Bezeichnungen genauso wenig geändert, wie die ambitioniert angelegte Roma-Dekade der EU, die 2005 begann.
Noch immer sehen sich die Roma einer tief verwurzelten sozialen Ausgrenzung und jahrhundertealten Vorurteilen gegenüber. "Im Niemandsland zwischen irritierender Alltagserfahrung und bruchstückhaftem historischen Wissen gedeiht üppig ein gedankliches und gefühlsmäßiges Unkraut", schreibt der langjährige Osteuropa-Korrespondent Norbert Mappes-Niediek in seinem Buch "Arme Roma, böse Zigeuner". Darin schaut er sich die oft hinter vorgehaltener Hand wiederholten Stereotype an.
Besondere Armutsgesellschaft
Es gibt zwei Sichtweisen auf die Roma: die rassistische - alle Roma stehlen und sind arbeitsscheu - und die idealisierte - alle Roma ziehen arm, aber lustig durch die Welt und musizieren gern. "Ich habe versucht, mir das möglichst vorurteilsfrei anzusehen", sagt Mappes-Niediek n-tv.de. "Was ich dabei entdeckt habe, ist in erster Linie eine Armutsgesellschaft, die allenfalls ein paar besondere kulturelle Züge trägt."
Der EU zufolge gehören Roma zu den am meisten von Armut, Arbeitslosigkeit und Analphabetismus betroffenen Gruppen auf dem Kontinent. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt, viele Roma lebten unter widrigsten Bedingungen in Elendsquartieren - ohne Trinkwasser oder sanitäre Anlagen. Mappes-Niediek betont denn auch, dass vieles, "was wir im positiven oder negativen als Romakultur interpretieren, im Prinzip nichts anderes als ein Verhalten ist, wie wir es bei Slumbewohnern und unter Armen überall auf der Welt antreffen". Die einzige Roma-Abgeordnete im Europäischen Parlament, die Ungarin Lívia Járóka, drückte es im Gespräch mit dem österreichischen "Standard" so aus: "Armut ist keine Tradition, sondern ein Umstand, dem jeder Mensch entkommen will. Tradition kann sich auf Fragen der Identität, Familienbeziehungen, Kunst oder Sprache beziehen, aber fehlendes Fließwasser oder Mangel an Medikamenten ist nichts, was man sich wünscht."
Aus der Not der Menschen entsteht eine Ökonomie der Armut, argumentiert Mappes-Niediek. Der Kampf um das tägliche Überleben lasse kaum Denkperspektiven zu. Es sei nicht rational für jemanden, der arm ist, von dem ganz wenigen, das er gelegentlich mal bekommt, auch noch zu sparen oder in eine Bildungskarriere zu investieren. "Er steckt in der häufig beschriebenen Armutsfalle und es gibt ein Verhalten, das dieser Armutsfalle entspricht."
Zu diesem Verhalten gehöre auch Kriminalität. Allerdings, meint Mappes-Niediek, relativiere ein Blick auf die Zahlen auch hier manch vorschnelles Urteil. Natürlich gebe es rund um die Slums Diebstähle und Kleinkriminalität, auch Raub. Nehme man als Vergleichsgröße aber nicht die Mehrheitsbevölkerung des Landes, sondern Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen wie die Roma leben, ergebe sich jedoch ein anderes Bild. "In den Favelas in Brasilien und in den Townships in Südafrika sind die Kriminalitätsraten rund um die Slums und vor allem in den Slums erheblich höher, vor allem bei der Gewaltkriminalität."
Erst das Fressen, dann die Moral
Ähnlich sieht es bei anderen Einschätzungen aus. Beispielsweise stehlen Roma mit Asylbewerberstatus nicht häufiger als andere Asylbewerber. Mappes-Niediek beschreibt sie alle als Menschen, "die mittel- und beschäftigungslos durch eine Überflussgesellschaft laufen".
Eine Legende sind auch die steinreichen Bettler. Europäische Untersuchungen belegen, dass Bettler in westeuropäischen Städten ungefähr 30 Euro am Tag verdienen, unabhängig von ihrer Herkunft. Für die Roma sind 30 Euro am Tag jedoch erheblich mehr als der Sozialhilfesatz in Ländern wie der Slowakei oder Ungarn. "Aber es ist auch immer noch weniger als bei uns die Grundsicherung ausmachen würde", gibt Mappes-Niediek zu bedenken. Dass sich Familienmitglieder oder Nachbarn an bestimmten Standplätzen abwechseln, kann man, wie es manche Städte es tun, als organisiertes Betteln verstehen oder als Optimierung eines Verdienstmodells. Auch dies ist eine Frage der Perspektive, wie vieles bei den Roma. Mappes-Niediek hat die Erfahrung gemacht, dass "man bei den Roma viele Dinge, die man bei anderen auf die Armut zurückführt, immer gleich kulturalisiert. Das sind eben die Zigeuner, ohne sich zu fragen, wie man selbst unter ähnlichen Bedingungen leben würde".
Verlierer der Transformation

Anhänger der rechtsextremen Jobbik-Partei marschieren durch das Roma-Viertel der ungarischen Stadt Miskolc.
(Foto: REUTERS)
1990 gab es beispielsweise in Rumänien 8,4 Millionen Arbeitsplätze, heute sind es 4 Millionen. Zu der Mehrheit, die ihren Arbeitsplatz verloren hat, gehören so gut wie alle Roma. Im Transformationsprozess der osteuropäischen Länder klafft inzwischen eine erhebliche Lücke zwischen den Armutsgesellschaften der Roma und der Mehrheitsbevölkerung. Deutlicher Ausdruck dieser Entwicklung sind die Roma-Slums von Plowdiw, Skopje oder Sofia. Von dort drängen die Menschen weg. Es zieht sie in die westeuropäischen Großstädte, aus finanziellen Gründen, auf der Suche nach Gesundheitsversorgung oder nach einer besseren Zukunft. Ob und auf welche Probleme sie treffen, ist vor allem eine Frage des Umgangs mit den Roma.
Frankreich versucht noch immer, die Betroffenen mit der Zahlung von etwa 300 Euro für jeden Erwachsenen zur Rückkehr in das Herkunftsland zu bewegen. Allerdings bemüht sich die Regierung von François Hollande, stärker auf die individuelle Situation der Roma einzugehen und nach entsprechenden Lösungen für Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Arbeitsmöglichkeiten und Schulbesuch der Kinder zu suchen. In Deutschland durchlaufen Roma das normale Asylverfahren, das nahezu immer mit der Ablehnung endet. Es gibt allerdings Städte, wie Berlin, die mit Modellprojekten Brennpunkte entschärft haben. Andere, wie Dortmund, müssen erst noch Strategien gegen den teilweise unkontrollierten Zuzug in leerstehende Wohnungen und den damit verbundenen Mietwucher entwickeln.
"Die Deutschen sind mehrheitlich keine Roma-Hasser", sagt Mappes-Niediek, "unsere Städte sind bunt. Jemand mit einer dunkleren Hautfarbe könnte auch aus Indien oder dem Iran kommen und ist nicht mehr automatisch ein Außenseiter. Die Voraussetzungen für Integration sind deshalb besser denn je." Das beste Beispiel seien zehntausende sogenannte Gastarbeiter-Roma, die den 1960er und 70er Jahren aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen sind. " Die leben mit ihren Nachfahren heute noch hier und sind so perfekt integriert, wie die jugoslawischen Gastarbeiter das allgemein waren. Die sagen nicht, wir sind Roma, und wir nehmen das nicht wahr. Das ist ein schöner Beweis dafür, dass die Kultur nicht das Problem ist."
Der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Romani Rose, hat vor der Einweihung des neuen Denkmals in Berlin gesagt, es setze ein Zeichen, "dass der Antiziganismus ('Zigeunerfeindlichkeit') genauso geächtet werden muss wie der Antisemitismus". Dies, möchte man hinzufügen, kann allerdings nur gelingen, wenn man die Roma nicht nur als ethnische, sondern auch als soziale Minderheit ansieht, als Bevölkerungsschicht, die besonders in Osteuropa von Massenarmut betroffen ist. "Im Grunde brauchen die osteuropäischen Länder so etwas wie einen New Deal nach dem Vorbild der USA in den 1930er Jahren", meint Mappes-Niediek. Dort habe es in allen großen Städten riesige Slums gegeben. Der New Deal habe die Emanzipation von Schwarzen, Iren oder Italienern aus diesen Slums überhaupt erst möglich gemacht. Infrastruktur- und Sozialpolitik für die osteuropäischen Gesamtgesellschaften statt Minderheitenpolitik könnten das sumpfige Niemandsland der Vorurteile austrocknen.
Quelle: ntv.de