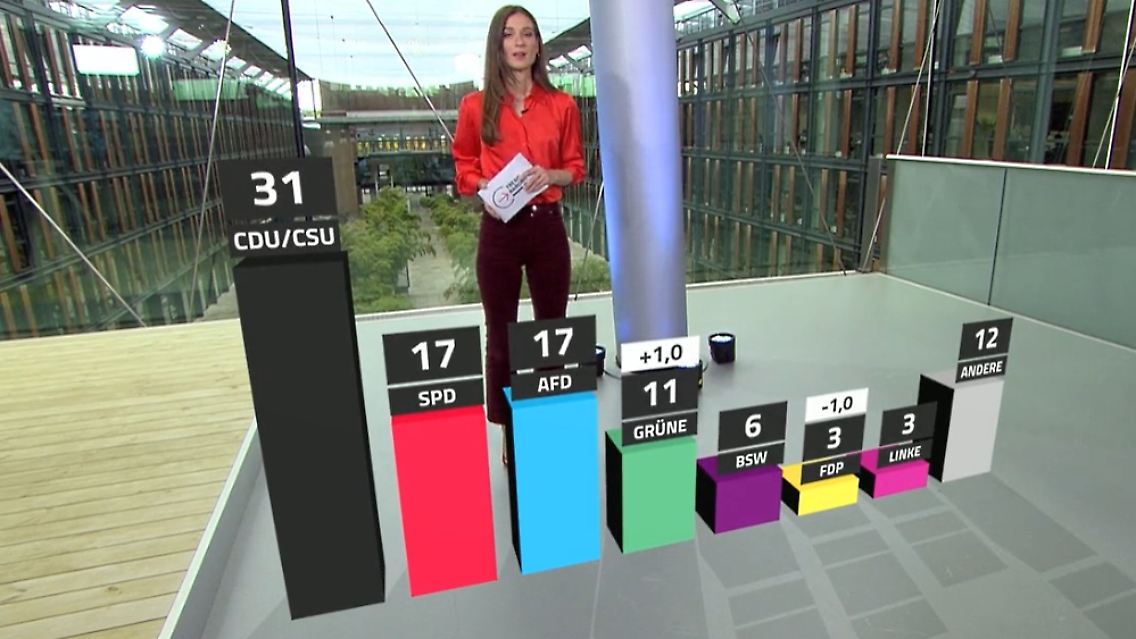Hohe Preise, teures Wohnen Das sind die größten Ängste der Deutschen
09.10.2024, 11:03 Uhr Artikel anhören
Beim alltäglichen Einkauf sind die Teuerungen spürbar.
(Foto: IMAGO/Zoonar)
Die Befragung zu den Ängsten der Deutschen zeichnen ein aktuelles Stimmungsbild der Gesellschaft. Durch multiple Krisen ist 2024 vor allem ein Ohnmachtsgefühl festzustellen, das viele sehr auf ihre persönlichen Belange schauen lässt. Aber es gibt auch Bereiche, in denen die Ängste nachgelassen haben.
Im aktuellen Ranking zu den Ängsten der Deutschen liegt die Sorge vor höheren Lebenshaltungskosten auf Platz eins. In der repräsentativen Studie "Die Ängste der Deutschen 2024" der R+V Versicherung antworteten 57 Prozent der Befragten, dass das ihre größte Furcht sei, teilt das Unternehmen mit. An zweiter Stelle folgt eine gesellschaftspolitische Sorge: 56 Prozent der Befragten befürchten, dass die Zahl der Geflüchteten die Deutschen und ihre Behörden überfordert. Eine weitere finanzielle Sorge belegt Platz drei der Studie: Mehr als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) befürchtet, dass Wohnen unbezahlbar wird.
"Die Menschen blicken mit Skepsis auf die aktuelle Entwicklung", so Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch zu den Studienergebnissen. "Hohe Tarifabschlüsse, Inflationsprämien und spürbar langsamer steigende Preise konnten den Deutschen ihre Sorgen nicht nehmen." Die Angst vor steigenden Preisen landet damit 2024 zum dritten Mal in Folge auf Platz eins. "Der Blick in unsere Langzeitstatistik zeigt: Wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, reagieren die Deutschen sensibel", berichtet Brower-Rabinowitsch. Die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten dominierte demnach öfter als jede andere Angst die Langzeitstudie. In den vergangenen drei Jahrzehnten lag sie insgesamt 14 Mal auf Platz eins und 7 Mal auf Platz zwei.
"Knapper Wohnraum, hohe Preise und viel Konkurrenz bei der Wohnungssuche - das bleibt eine Mixtur mit sozialem Sprengstoff", erklärt Isabelle Borucki zur Sorge, dass Wohnen unbezahlbar wird. Die Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg begleitet die R+V-Studie als Beraterin. Nach der Furcht vor unbezahlbarem Wohnraum wird seit 2022 gefragt- sie landete jedes Jahr auf einem der ersten drei Plätze.
Keine Angst um den Job
Die Menschen sorgten sich um ihre individuelle finanzielle Sicherheit, so Borucki. Die Konfrontation mit multiplen Krisen, wie der angespannten wirtschaftlichen und geopolitischen Lage, lösten starke Verunsicherung aus. "Dieses Ohnmachtsgefühl führt dazu, dass sich der Fokus auf persönliche Belange verschiebt."
Die Studie zeigt jedoch auch Entspannung. "Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Ängste vor hohen Lebenshaltungskosten und vor teurem Wohnraum - um jeweils acht Prozentpunkte", sagt Brower-Rabinowitsch. "Die Menschen haben mehr Geld im Portemonnaie. Das bleibt nicht ohne Wirkung." Ein Rückgang des Angstniveaus lässt sich ebenfalls bei zwei weiteren wirtschaftlichen Themen beobachten, die 2023 weit vorn im Ranking lagen: Die Hälfte der Deutschen hat Angst, dass der Staat wegen der Schuldenlast die Steuern erhöht oder Leistungen kürzt, Platz fünf der Studie (2023: 57 Prozent, Platz drei). Vor einer schlechteren Wirtschaftslage fürchten sich 48 Prozent der Befragten (Platz acht). 2023 belegte diese Furcht mit 51 Prozent noch Platz fünf.
Der Blick auf den Arbeitsmarkt löst derzeit kaum Ängste aus. Knapp ein Drittel der Befragten (30 Prozent) fürchtet, dass die Arbeitslosenzahlen in Deutschland steigen. Noch geringer ist die Angst der Beschäftigten um ihren eigenen Arbeitsplatz. Sie liegt bei 22 Prozent - der letzte Platz im Ranking. "Das ist eine gute Nachricht. Noch weniger Angst um den eigenen Job hatten die Menschen noch nie in der Geschichte der Studie", so Brower-Rabinowitsch.
"Zuwanderung und Integration nicht auf die leichte Schulter nehmen"
Hingegen zeigt die Studie, dass gesellschaftspolitische Themen an Gewicht gewinnen. Dazu zählen laut Brower-Rabinowitsch "vor allem Migration und die Furcht vor politischem Extremismus." 56 Prozent der Befragten sorgen sich, dass die Zahl der Geflüchteten den Staat überfordert (2023: 56 Prozent, Platz vier). 51 Prozent der Befragten fürchten, dass es durch den weiteren Zuzug aus dem Ausland zu Spannungen innerhalb der Gesellschaft kommt - Platz vier der aktuellen Untersuchung (2023: 47 Prozent, Platz zwölf). Im Vergleich zu 2023 sind die Migrationssorgen nicht oder nur leicht gestiegen.
Beide Sorgen liegen auch deutlich unter dem Höchststand vom Jahr 2016. Damals - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle - fürchteten zwei von drei Befragten, dass der Staat überfordert ist oder es durch weiteren Zuzug aus dem Ausland zu Spannungen kommt. "Das bedeutet aber nicht, dass man die aktuellen Ängste auf die leichte Schulter nehmen darf. Im Gegenteil. Grundlegende Probleme bei der Zuwanderung und Integration wurden lange nicht angegangen - das wurde schlicht verschlafen", mahnt Borucki. "Hier ist die Politik dringend gefordert. Und zwar ohne die aufgeladene Stimmung in Teilen der Gesellschaft noch weiter anzuheizen."
Bei den Zuwanderungsthemen gibt es demnach Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. "In Ostdeutschland bereitet die Migration den Menschen mehr Sorgen als in Westdeutschland", stellt Studienleiter Brower-Rabinowitsch fest. 60 Prozent der Befragten in den östlichen Bundesländern fürchten, dass die Zuwanderung den Staat überfordert, im Westen sind es 55 Prozent. Vor Spannungen durch weiteren Zuzug haben im Osten 56 Prozent Angst, im Westen 50 Prozent. "Gerade im Osten herrscht in Teilen der Gesellschaft das Gefühl, ungleich und unfair behandelt zu werden. Das Fremde, die Geflüchteten und deren Zuzug werden als Bedrohung empfunden", erklärt Politikwissenschaftlerin Borucki. Ein gesamtdeutsches Thema ist mit 48 Prozent die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Das bereitet den Menschen im Westen genauso viel Sorgen wie im Osten", sagt Brower-Rabinowitsch.
Terror-Ängste wachsen wieder
Mit acht Prozentpunkten hat die Angst vor politischem Extremismus in diesem Jahr am stärksten zugenommen. Sie bereitet 46 Prozent der Menschen große Sorgen. Brower-Rabinowitsch erinnert: "Kurz vor der ersten Befragungswelle der Studie war der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim." Doch welche Art von Extremismus meinen die Befragten? 48 Prozent fürchten sich vor islamistischem Terror, 38 Prozent vor Rechtsextremismus und sieben Prozent vor Linksextremismus. Ebenfalls spürbar gestiegen - um fünf Prozentpunkte - ist die Angst vor Terrorismus. Sie liegt jetzt bei 43 Prozent.
Doch es gibt auch positive Signale: Insgesamt hat sich die Stimmung der Deutschen 2024 etwas aufgehellt. Der Angstindex - der durchschnittliche Wert aller gemessenen Ängste - fällt auf 42 Prozent (2023: 45 Prozent).
Für die Langzeitstudie hat die R+V 2400 Menschen nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit befragt. Es ist die 33. Befragung in Folge.
Quelle: ntv.de, sba