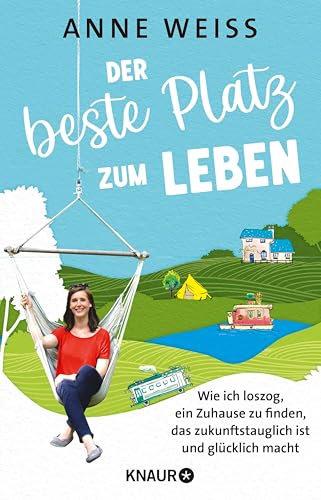Suche nach dem Platz zum LebenGemeinschaftlich Wohnen - ein Konzept der Zukunft?

Der Wohnungsmarkt ist rau, die Einsamkeit nimmt zu und die klassische Familie ist längst nicht mehr das einzige Lebensmodell. Zeit also für neue Wohnformen - zum Beispiel gemeinschaftliche Wohnprojekte, die mehr bieten möchten, als nur ein Dach über dem Kopf.
Wohnen ist in Deutschland zu einem drängenden Thema geworden, das die Menschen umtreibt und viele Fragen aufwirft: Wie kann Wohnen in Zukunft gerecht und sozial gestaltet werden? Wo, wie und mit wem möchten wir leben? Darauf wollte auch Anne Weiss eine Antwort finden. Sie hat sich auf die Suche gemacht, was für sie "Der beste Platz zum Leben" sein könnte, so der Titel ihres Buches. Der Anlass war ein sehr konkreter: In ihrer Berliner Altbauwohnung direkt unter dem Dachboden kam die Decke runter, es bildete sich ein fußballgroßes Loch und ständig bröckelte matschiger Putz auf den Boden. Außerdem war die Wohnung so schlecht isoliert, dass sie im Winter den Spitznamen "Alaska" verdiente.
Zeit also, sich etwas Neues zu suchen, fand die Autorin. Aber sie wollte "keine Wohnung von der Stange", erzählt sie im Gespräch mit ntv.de. Sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, "herausfinden, was es jenseits des extrem angespannten Wohnungsmarkts noch gibt, wo ich vielleicht zu eng denke, wo noch Möglichkeiten sind, die ich bis dahin nicht gesehen habe".
Seit Jahren ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft. Besonders in Großstädten wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Auf der Rangliste der "Ängste der Deutschen" steht die Sorge, die Wohnung zu verlieren, im Jahr 2023 auf Platz zwei. Demzufolge befürchten sechs von zehn Menschen, sich ihre Wohnung oder ihr Haus irgendwann nicht mehr leisten zu können. Gleichzeitig finden gesellschaftliche Veränderungen statt. Im Jahr 2022 lebte laut dem Statistischen Bundesamt in 41 Prozent der Haushalte nur eine Person. Außerdem gibt es inzwischen sehr viel mehr Lebensmodelle als die klassische Familie, die eine Dreizimmerwohnung mit Küche, Bad, Balkon bewohnt.
Bei ihrem Experiment probierte Weiss alternative Wohnkonzepte aus, die sie "vorwiegend nach Lust und Laune und natürlich auch nach ökologischen Maßstäben" auswählte. Sie bezog verschiedene Tiny-House-Varianten, eines davon zum Beispiel in einer Eisenbahnwaggon-Siedlung, half in einem Ökodorf, den Garten für die Obst- und Gemüseselbstversorgung zu pflegen, und lebte in einer Jurte mit Kompostklo besonders naturnah. So unterschiedlich die Unterkünfte auch waren, in einem Punkt glichen sich viele der Wohnformen: Menschen haben sich entschieden, ihren Wohnraum und ihr Zusammenleben selbst zu organisieren und in Gemeinschaft zu gestalten.
"Wahlfamilie" und Netzwerk im Alter
In fast jeder größeren Stadt bringen Netzwerke inzwischen Menschen miteinander in Kontakt, die ein Wohnprojekt gründen oder sich einem bereits bestehenden anschließen möchten. Die Wohnformen sind dabei ganz unterschiedlich und reichen von der Senioren-WG über das Mehrgenerationenhaus bis hin zu Siedlungsgemeinschaften, die ein eigenes Dorf bewohnen. Die Menschen, die sich für gemeinschaftliches Wohnen interessieren, kommen grundsätzlich aus allen Schichten und Generationen, sagt Helene Rettenbach ntv.de. Sie hat 35 Jahre lang Wohnprojekte in der Entstehungsphase beraten und ist heute noch für den Förderverein Gemeinsames Wohnen Jung und Alt in Darmstadt tätig.
Rettenbachs Erfahrung nach liegt der Schwerpunkt aber auf zwei Gesellschaftsgruppen. Zum einen seien es ältere Menschen, vor allem allein lebende Frauen, die sich fragten, wie es nach dem Ende der Berufslaufbahn weitergeht. Und die "nicht nur allein irgendwo Kreuzworträtsel lösen, sondern was inhaltlich Sinnvolles" tun wollen, zum Beispiel sich innerhalb einer Gemeinschaft engagieren. Auch drohende Einsamkeit im Alter spiele für viele eine Rolle. Wenn der Radius sich verkleinere und Freunde und Familie nicht mehr da seien oder weit weg wohnten, möchten sich viele ein soziales Netz in der Nähe aufbauen, "und dafür muss man relativ früh was tun, damit es dann hinterher auch trägt".
Die andere Gruppe bilden junge Familien, die sich oft mehr wünschten als eine "normale Nachbarschaft, wo es gut gehen kann oder auch nicht, und wenn man sich streitet, holt man halt den Anwalt", so Rettenbach. Sie seien eher auf der Suche nach alternativen Lebensformen, nach einer "Wahlfamilie", bei deren Zusammensetzung sie mitentschieden können.
In solchen Wohnprojekten stellt sich natürlich immer die Frage: Wie viel Nähe darf, wie viel Distanz muss sein? Die Antwort darauf beeinflusst auch die Architektur und macht es häufig schwieriger, auf Bestandsimmobilien zurückzugreifen. Aber egal ob Neu- oder Umbau: Die Umsetzung der Wohnvorstellungen ist immer mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Gemeinschaftliches Wohnen sei nicht per se günstiger als andere Wohnformen, erklärt Rettenbach. Die Räume können dann aber an die individuellen Anforderungen - zum Beispiel wie viel privat und gemeinschaftlich genutzte Fläche benötigt wird - angepasst werden.
Das führt zu kreativen und klugen Lösungen. Anne Weiss berichtet von ihrem Besuch in einem Mehrgenerationenhaus im Bremer Klimaquartier, wo sich in den einzelnen Wohneinheiten die Wände verschieben lassen. Die Bewohner und Bewohnerinnen seien also "nicht gezwungen, mit einer neuen Lebensphase in eine neue Umgebung zu ziehen". Wenn sich zum Beispiel eine Partnerschaft auflöst oder die Kinder aus dem Haus sind, könne die Wohnung ohne Probleme verkleinert und dadurch auch wieder neuer Wohnraum geschaffen werden.
Dem Spekulationskreislauf entkommen
Einen verantwortungsvollen Umgang mit Wohnraum, der nicht in erster Linie auf Profit aus ist, formulieren die meisten Wohnprojekte als eines ihrer Ziele. Sie wollen Rettenbach zufolge "aus diesem Spekulationskreislauf des Wohnungsmarktes raus." Auch das Sicherheitsgefühl spiele für viele eine große Rolle, erklärt Weiss: "Die Menschen, die sich den Wohnraum selber schaffen oder aktiv an so einem Projekt gestalterisch tätig sind, erfahren nicht nur Selbstwirksamkeit. Es ist auch diese Vorstellung: Da kann ich meine Beine ausstrecken, mit anderen gemeinschaftlich zufrieden leben und ich muss keine Angst haben, rausgeschmissen zu werden."
Trotzdem ist selbst in nach außen hin idyllisch wirkenden Gemeinschaften nicht immer alles nur Bullerbü. Auch in Wahlfamilien wird gestritten. Während ihres Wohnexperiments hat Weiss aber die Erfahrung gemacht, dass "die meisten der Wohnprojekte eine Form gefunden haben, Konflikte auszutragen, sodass es nicht so endet, wie wir das aus WGs kennen: Zwei Wochen lang mit so einer Schnute beleidigt durch die Wohnung zu laufen oder sich anzuschreien."
Rettenbach rät selbstorganisierten Wohnprojekten dazu, sich Regeln zu geben und dann auch Willens zu sein, sie einzuhalten. Dabei kann es um die Frage gehen, wie das Zusammenleben organisiert sein soll, ob zum Beispiel Entscheidungen im Konsens oder mehrheitlich gefällt werden. Auch könne festgehalten werden, welche Ziele die Gemeinschaft verfolgt, wie nachhaltig sie leben will und ob bestimmte Dinge geteilt werden.
"Ein bisschen mehr soziale Kontrolle"
Und dann ist da noch ein Punkt, an den besonders Menschen, die bisher in einem anonymen Wohnblock oder in einer eher distanzierten Nachbarschaft gelebt haben, sich vielleicht erst gewöhnen müssen: "Es kann ein bisschen mehr soziale Kontrolle geben", sagt Rettenbach. Seit sie selbst in einem Gemeinschaftsprojekt lebe, setze sie lieber immer den Helm zum Fahrradfahren auf. "Man sieht halt, wenn ich auf den Hof fahre. Und ich werde im Zweifel auch darauf angesprochen". Aber für sie sei das kein Problem: "Kommunikation ist ein wichtiger Teil von einem Wohnprojekt."
Das wird vielleicht auch Anne Weiss bald erleben. Sie möchte weiterhin mit ihrem Mitbewohner, den Leserinnen und Leser aus ihrem Buch kennen, zusammenwohnen. Gemeinsam sind sie auf einem guten Weg, den "besten Platz zum Leben" zu finden: "Wir haben uns schon zwei ökologische Wohnprojekte im Norden ausgeguckt - im Grünen, aber trotzdem mit guter Anbindung an die Stadt, zusammen mit Menschen, die ökologisch denken und auch so wohnen wollen, wie wir uns das vorstellen."