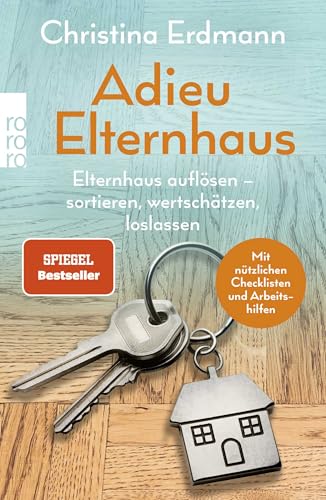Emanzipation erwachsener KinderWie der endgültige Abschied vom Elternhaus gelingt
 Von Solveig Bach
Von Solveig Bach
Beim Wort Elternhaus hat jeder sofort Bilder vor Augen: vertraute Zimmer, Gardinen oder ein bestimmtes Licht. Manchmal ist dieser Kindheitsort auch eine Wohnung. Und wenn die Eltern alt werden oder sterben, muss das Elternhaus aufgelöst werden. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur das Loslassen von alten Möbeln.
"Meine Eltern konnten gesundheitsbedingt ihr Haus nicht mehr halten und mussten sich von 240 auf 70 Quadratmeter verkleinern", erzählt Christina Erdmann ntv.de. Im November 2011 hatten Erdmanns Eltern beschlossen, in eine seniorengerechte Wohnung zu ziehen. Für sie und ihre Schwester bedeutete das, das Haus zusammen mit dem Vater und der Mutter auszuräumen. Es war das Haus, in dem die Eltern mehr als 34 Jahre gelebt hatten.
"Als wir damals angefangen haben, meinen Eltern zu helfen, war mir klar, dass wir viel Zeit brauchen würden. Aber vor allem hätte ich gern gewusst, wie emotional anstrengend das selbst für mich als Helferin wird", sagt die Berlinerin, die in Bochum lebt, heute rückblickend. Inzwischen hat sie einen Ratgeber für Menschen in dieser Situation geschrieben: "Adieu Elternhaus - Elternhaus auflösen - sortieren, wertschätzen, loslassen".
Bevor plötzlich das Ausräumen anstand, hatte Erdmann einen völlig anderen Blick auf den Ort, an dem ihre Eltern lebten. "Das sind einfach die Sachen der Eltern. Man denkt hier und da vielleicht, das könnten wir auch mal wegwerfen, aber man muss nichts tun." Doch mit der Entscheidung, die Wohnung oder das Haus aufzugeben, ändert sich alles. "Für mich war das schwierig, weil es sich falsch angefühlt hat, alles in die Hand zu nehmen und rauszunehmen. Es war eine Herausforderung, sich vorzustellen, dass dieser Ort demnächst nicht mehr existiert."
Was ist mir wichtig?
Heute rät sie Menschen, die sie in ähnlichen Situationen um Hilfe bitten: "Sortieren Sie sich erstmal selbst und dann die Dinge." Was schlicht und überzeugend klingt, kann tatsächlich dem einen ganz leichtfallen und für den anderen eine fast unmögliche emotionale Aufgabe sein. Denn es geht um weitreichende Fragen. "In der Regel sind Menschen nach dem Tod der Eltern völlig überwältigt von Trauer und Schmerz. Oder sie sind ratlos, was deren weiteres Schicksal, zum Beispiel nach einem Sturz oder bei fortschreitender Demenz, angeht. Umso wichtiger ist es, wenn man sich vorher klargemacht hat: Was verbindet mich mit dem Elternhaus und den Dingen darin? Was ist mir wichtig? Was sind Sachen, bei denen es mir zwar wehtut, sie wegzugeben, bei denen es aber nicht anders geht? Bin ich eigentlich verbunden mit dem Ort oder ist er eine Belastung, sodass ich erleichtert bin, ihn jetzt loszuwerden?"
Erdmann entschied sich gewissermaßen aus Einsicht für mehr Selbstfürsorge. "Ich dachte, wenn mich während dieser ganzen Räumerei meine Gefühle sowieso immer wieder einholen und wir nur langsam vorankommen, weil wir uns immer wieder in Erinnerungen verlieren, kann ich aus der Not eine Tugend machen und mich auch ganz bewusst mit der Geschichte dieses Ortes und mit der Geschichte meiner Familie beschäftigen."
In ihrem Buch schlägt die Autorin vor, das Haus oder die Wohnung im ursprünglichen Zustand zu fotografieren, also bevor das eigentliche Räumen beginnt. Auch wenn man es sich mitten im Ausräumen kaum vorstellen kann, wird die Erinnerung später schnell "löchrig". So kann man auch nach Jahren durch die Räume bummeln oder seine Erinnerungen mit den Bildern abgleichen. Oder man kann, wenn alles losgelassen ist, die Bilder bewusst löschen, um auch symbolisch einen Abschluss zu schaffen. Erdmann betont immer wieder, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Deshalb ist es aus ihrer Sicht so wichtig, den eigenen Weg bewusst zu finden und zu beschreiten.
Anhand von Zimmern oder Orten, Möbelstücken, Gerüchen, Stoffen oder Klängen empfiehlt sie, die schönen wie die weniger schönen Erinnerungen aufzuschreiben. Diese sehr persönlichen Aufzeichnungen, die der eigenen Sortierung und Verortung dienen und die sie das "emotionale Klingelschild" nennt, müssen nur für einen selbst stimmig sein und können sich beispielsweise von denen der Geschwister erheblich unterscheiden. In diesem Fall ist keine Einigkeit nötig, bei anderen Fragen schon.
Alte Wunden
Auch wenn Erdmann keine juristische Beratung gibt, rät sie, alle Dokumente sehr sorgfältig zu sammeln und aufzubewahren. Dazu gehören neben persönlichen Dokumenten unter anderem Grundrisse, Versicherungspolicen, aber auch Umbauunterlagen, der Grundbuchauszug oder der Mietvertrag. Vor allem im Fall eines späteren Verkaufs werden diese Papiere noch gebraucht. Wenn man nicht allein mit der Aufgabe ist, wird man auch nicht umhinkommen, sich mit den "bedeutsamen anderen", wie Erdmann sie nennt, abzustimmen. Das können Geschwister sein oder im Todesfall Miterben, die eigenen Kinder oder liebe Freunde der Eltern.
Sie selbst und ihre Schwester hätten das gut hinbekommen, sagt Erdmann und betont, dass das vermutlich oft der Fall sei. "Es gibt viele Geschwister, die miteinander wunderbar klarkommen und auch kein Problem mit irgendwelchen Rechtsthemen haben." Häufig allerdings werde das Ausräumen und Aufteilen unbewusst zu einer letzten Möglichkeit für "Rache oder den Wunsch nach Wiedergutmachung für subjektiv empfundene Ungerechtigkeiten". Auf den ersten Blick mag es um die Frage gehen, wer die Armbanduhr des Vaters oder den Lieblingssessel der Mutter bekommt, doch darunter lägen Fragen nach Liebe und Anerkennung, die aus der Kindheit stammten, so Erdmann.
Sicher wäre es hilfreich, dass diese Konfliktherde vorher besprochen werden. Aber das ist nicht immer möglich. "Vielleicht können Geschwister, die kein so gutes Verhältnis zueinander haben, bevor sie im Haus starten, ein paar grundlegende Vereinbarungen miteinander treffen", schlägt Erdmann vor. Dabei gehe es nicht darum, sich wieder versöhnt in den Armen zu liegen. Aber man könne vielleicht sagen: "Egal, welchen Groll jeder von uns mit den Eltern oder auch miteinander herumschleppt, wir versprechen, uns hier nicht zu streiten." Vielleicht hat man auch hinterher kein gutes Verhältnis, aber wenigstens habe man während des Elternhaus-Auflösens nicht immerzu gestritten.
Manchmal helfe es auch, sich "bewusst zu sagen: Wir hatten völlig unterschiedliche Eltern. Sie haben dich ganz anders behandelt als mich. Wir lassen diese ganzen alten Geschichten außen vor und gucken: Was passt zu wem? Wer würde gern was haben? Und wenn es alle wollen, kann man sich auf ein Losverfahren einigen. Wenn man das vorher besprechen würde, würde es an vielen Stellen für jeden einzelnen Beteiligten leichter werden."
Nicht zuletzt könnten die Eltern auch festlegen, wie etwas gehandhabt werden soll, anstatt die Klärung den Kindern zu überlassen. Die damit verbundene Enttäuschung und Wut werden manchmal hinderlich beim Ausräumen, weil die emotionale Belastung es schwieriger macht, kluge Entscheidungen zu treffen. "Wenn man unterdrückte Wut auf die Eltern mal rauslässt, am berühmten Sandsack oder beim Schreien im Wald, kann es tatsächlich hinterher einfacher sein, doch irgendwas geschafft zu kriegen im Haus", beschreibt Erdmann ihre Erfahrung.
Es sind die kleinen Dinge
Auch für das ganz praktische Räumen hat sie einige Tipps. Etwa den, eine Tasche unter anderem mit Mülltüten, Seife und Handcreme parat zu haben, denn das elterliche Zuhause aufzulösen ist in der Regel auch eine staubige, dreckige und körperlich anstrengende Angelegenheit. Zumal der normale Alltag meist weitergeht. Wer kann, sollte deshalb andere Routineaufgaben versuchen zu delegieren. Auch für diese Schritte enthält Erdmanns Buch Checklisten, die einem helfen, den Überblick zu behalten.
Wer sich vor dem Ausräumen des Elternhauses oder der elterlichen Wohnung fürchtet, dem kann Erdmann trotzdem auch Ermutigung geben. "In dem Moment, wo man ins Haus kommt und die Eltern sind entweder gestorben oder leben dort nicht mehr, verändert sich der Erinnerungswert der Dinge." Gegenstände, die man früher für unverzichtbar hielt, lässt man nun oft erstaunlich leicht los. "Das ist ein Emanzipationsprozess des erwachsenen Kindes. Viele erleben sich in dieser Situation plötzlich ganz neu. Sie versuchen nicht mehr, im Sinne der Eltern zu handeln, ohne zu wissen, ob die gut finden würden, wie man das macht." Erdmann rät daher auch, so zu entscheiden, dass man mit den Konsequenzen einer Entscheidung vor allem selbst gut weiterleben kann.
Überraschenderweise sind es selten die ganz großen Dinge, die man am Ende wirklich behalten will. Im Fall von Christina Erdmann war es eine Vase, die ihr Vater beim Ausräumen völlig selbstverständlich wegwerfen wollte. "Bevor ich nachdenken konnte, hörte ich mich sagen: auf gar keinen Fall. Die will ich haben." Die Vase habe 34 Jahre in einer Nische auf dem Schuhschrank der Eltern gestanden. "Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet das meine Erinnerung an die Wohnung meiner Kindheit und an meine Jugend in diesem Haus ist."