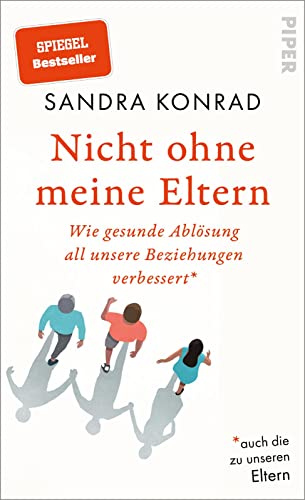Lebenslanger Ablösungsprozess"Viele quälen sich mit Lebensaufträgen der Eltern"
 Von Solveig Bach
Von Solveig Bach
Als Kind ist man auf die Eltern angewiesen, sie sind geradezu lebensnotwendig. Doch auch bei vielen Erwachsenen ist das Verhältnis zu Mutter und Vater Dauerthema und oft von Konflikten belastet. Dahinter könnten Verstrickungsmuster stecken, die ein eigenes, selbstbestimmtes Leben verhindern.
Ein gutes Verhältnis zu den Eltern, das wünschen sich viele Erwachsene. Die gesellschaftliche Erwartung ist, dass Eltern ihre erwachsenen Kinder beispielsweise bei der Betreuung der Enkelkinder unterstützen und sich umgekehrt erwachsene Töchter und Söhne in die Pflege der alternden Mütter und Väter einbringen.
Die Realität sieht für viele jedoch anders aus. Da fordern beispielsweise Eltern Berührungen ein, die erwachsene Kinder nicht mehr geben möchten. Bei der Betreuung der Enkelkinder gibt es übergriffige Bemerkungen oder Handlungen. Für die Psychologin Sandra Konrad sind diese Art der Beziehungen zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern deutliche Zeichen für eine Verstrickung. Diese hindere Menschen daran, ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben zu leben.
Konrad hat über diese Verstrickungen das Buch "Nicht ohne meine Eltern" geschrieben. Die Ursachen dafür, dass sich viele Menschen noch weit in ihr Erwachsenenleben hinein unfrei und gebunden an die Erwartungen der Eltern fühlen, sieht sie in nicht altersgerecht vollzogenen Ablösungsprozessen in der Pubertät und in den jungen Erwachsenenjahren. "Gerade in Familien, in denen eine zu starke oder kranke Loyalität gefordert und installiert wird, ist es ganz schwer, diesen Ablösungsprozess angemessen und gesund zu vollziehen, weil die Eltern wirklich alles boykottieren", sagt Konrad im Gespräch mit ntv.de.
Über diese ungesunde Loyalität blieben die Betroffenen so stark an die Eltern gebunden, dass sie oft sogar noch die eigenen Kinder diesen elterlichen Erwartungen und Aufträgen aussetzen. "Viele quälen sich mit Lebensentwürfen, die von den Eltern vorgegeben wurden, häufig, ohne dass es ihnen bewusst ist", schreibt Konrad in ihrem Buch.
Dankbarkeit und Schuld
Die Ablösung von den Eltern sei "kein einzelner Schritt, sondern das ist wirklich ein langer, zum Teil ein lebenslanger Prozess", erläutert die Psychologin, die seit mehr als 20 Jahren als systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin in Hamburg in ihrer eigenen Praxis arbeitet. Dabei gehe es darum, sich von der Zustimmung zu Lebensentscheidungen so weit unabhängig zu machen, dass eigenständige Schritte möglich werden. Dazu müssen Menschen zunächst die "Erwartungen der Eltern an uns hinterfragen und das aussortieren, was nicht passt", sagt Konrad.
Dieses Hinterfragen hat es in sich. Muss ich wirklich studieren, heiraten, Kinder bekommen, ein Haus kaufen, Auto fahren, immer perfekt sein? Wer bin ich? Will und mache ich das Richtige? Dahinter stehe die existenzielle Frage: Werde ich auch geliebt, wenn ich meinen eigenen Weg gehe? Oft verbinden Eltern mit bestimmten Auffassungen oder Aufträgen die Idee, dass sich in deren Erfüllung die Dankbarkeit der Kinder ausdrückt - für finanzielle Mittel, Zeit oder auch einfach das Zurückstecken, das mit der Erziehung von Kindern auch einhergeht.
"Man kann den Eltern durchaus dankbar sein, aber es gibt keine filiale Schuld", sagt Konrad dazu. Mit filialer Schuld meint die Psychologin Pflichten, die wir allein aufgrund des Umstandes haben, dass wir Tochter oder Sohn von jemandem sind. "Viele können wertschätzen, was die Eltern ihnen gegeben haben." Aber wenn Eltern die Beziehung zu Töchtern und Söhnen mit Schuld aufladen, entwerten und verzerren sie die Grundkonstellation, dass sich die Eltern ja für die Kinder entschieden haben. Wirklich tiefe Bindung entstehe aber nicht aus Schuld, sondern aus Liebe. "Dann kann Dankbarkeit und eine gesunde Loyalität entstehen und auch der Wunsch, für die Eltern da zu sein. Aber das entsteht freiwillig."
Mehr als versagende Eltern
Es gibt jedoch noch einen zweiten wichtigen Teil der Ablösung, betont die Psychologin. "Dass wir die eigenen Erwartungen an die Eltern hinterfragen und irgendwann aufhören, uns die Eltern so zu wünschen, wie sie nie waren und nie sein werden." Dieser Punkt sei sehr schmerzhaft für ganz viele Menschen, "gerade weil sie ihr ganzes Leben lang etwas nicht bekommen haben". Selten seien das materielle Dinge, "aber auf der emotionalen Ebene merken einfach viele Erwachsene, wo ihre Defizite liegen, und dass das eben ganz viel mit ihrem Aufwachsen zu tun hat". Bei der Akzeptanz helfe es, die Eltern "aus einer erwachseneren Brille heraus zu betrachten und ganzheitlicher zu sehen".
Die eigene Mutter und der eigene Vater sind immer mehr als nur versagende Eltern, die Fehler gemacht haben. Wer in die Kindheit der Eltern zurückgeht, könne vielleicht verstehen, "dass die Eltern uns in Anbetracht ihrer eigenen Kindheitserfahrung oft schon die besten Eltern gewesen sind, die sie sein konnten. Auch wenn das für uns oftmals nicht gut genug war." Oft entstehe schon daraus innerer Frieden.
Vor allem aber rate sie ihren Klientinnen und Klienten, sich selbst die Mutter oder der Vater zu werden, die sie sich gewünscht hätten. Konrad schildert dazu eine Metapher. "Stell dir vor, deine Mutter konnte nie kochen und du isst aber gerne. Jetzt bist du erwachsen, hast immer noch oft Hunger und wünschst dir, wenn du zu deiner Mutter fährst, soll sie dir etwas Schönes kochen." Jetzt könne man sehr hungrig dort hinfahren und dann wütend werden, weil die Mutter immer noch nicht gelernt hat zu kochen. Oder man könnte anerkennen, dass das nicht passieren wird und etwas verändern, erläutert die Psychologin.
Mit ihren Klientinnen und Klienten sammelt Konrad dann Ideen, wie sie mit der Situation umgehen könnten. Vielleicht könnte man selbst kochen lernen, dann wäre man nicht mehr abhängig von der Mutter. "Ich könnte meine Mutter aber auch ins Restaurant einladen oder ich könnte gemeinsam mit ihr kochen. Oder ich könnte uns beide zum Kochkurs anmelden." In keinem Fall würde man hungrig bleiben, vielleicht hätte man sogar eine gute Zeit zusammen.
"Das ist das Schöne beim Sich-selbst-Versorgen, dass ich mir genau das geben kann, was ich brauche. Oder eben andere Menschen in meinem Umfeld", sagt Konrad. "Dann komme ich aus dieser kindlichen, ohnmächtigen Opferhaltung raus, in der ich eigentlich noch einen Retter oder eine Retterin brauche."
Der Tod ist nicht das Ende
Ohnehin sei die Zeit mit den Eltern begrenzt und ende spätestens mit ihrem Tod. "Das ist der letzte Abschied von den Eltern. Wenn sie gestorben sind, gibt es die Realität der unangenehmen Begegnungen, der überhöhten Erwartungen nicht mehr." Was nicht wegfällt, seien die inneren Glaubenssätze, "nach denen wir leben, wie wir uns selbst oder die Welt betrachten, die auch ausschlaggebend für unser Selbstwertgefühl sind, und ob wir unsere Bedürfnisse erkennen oder nicht, ob wir gesunde Grenzen etablieren können oder ob wir überhaupt nicht wissen, wo unsere Grenzen sind." Die emotionale Arbeit daran werde oft nach dem Tod der Eltern sogar noch dringender.
Denn laut Konrad neigen Menschen dazu, ihre ungelösten Konflikte mit den Eltern auch mit allen anderen Personen auszuagieren. Das können Kinder, Partnerinnen oder Chefs sein. Sie sollen uns bedingungslose Liebe, Aufmerksamkeit oder Anerkennung geben. "Wenn sie uns an den Vater oder die Mutter erinnern, dann reagieren wir darauf häufig nicht als erwachsener Mensch, sondern wir werden in ein Kindheits-Ich zurückgetriggert und reagieren dann aus diesem kindlichen Anteil heraus." Jeder kenne das, dass man in bestimmten Situationen nicht situationsangemessen, sondern überreagiert. Oft schwemmen die Gefühle einen wie eine große Welle hinweg. Als Therapeutin frage sie dann nach, wie alt sich die Menschen in diesen Situationen fühlen.
Um die Ablösung komme niemand herum, betont Konrad. Wenn die eigene Freiheit als Motivation für die Arbeit daran nicht ausreicht, helfe es vielleicht, sich klarzumachen, dass man die Verstrickungen sonst weitergibt. "Es ist ganz wichtig, dass eine Person irgendwann mal aussteigt, Verantwortung übernimmt, versteht, was passiert ist und sich selbst versorgt." Dann können Eltern wie Kinder und Kindeskinder ein eigenes, selbstbestimmtes und glückliches Leben führen.