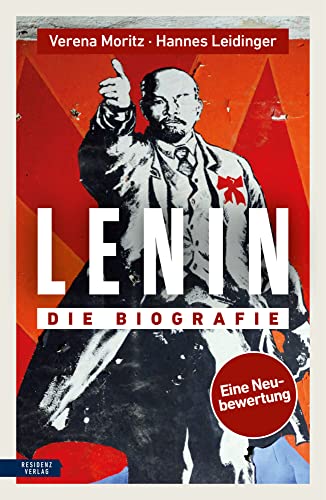Interview zum 100. Todestag"Lenin war kein deutscher Agent"

Auch 100 Jahre nach seinem Tod wird Lenin mitunter als idealistischer Revolutionär gesehen, der Gewalt nur notgedrungen in Kauf nahm. Dagegen sagt der Historiker Hannes Leidinger, schon Lenins frühe politische Konzepte seien "untrennbar mit Gewalt verbunden".
Auch 100 Jahre nach seinem Tod wird Lenin - anders als sein Nachfolger Stalin - von manchen Linken als idealistischer Revolutionär gesehen, der Gewalt nur notgedrungen in Kauf nahm. Dagegen sagt der Historiker Hannes Leidinger, schon Lenins frühe politische Konzepte seien "untrennbar mit Gewalt verbunden". Dennoch will der heutige Machthaber im Kreml mit Lenin nicht zu viel zu tun haben: "Aus Putins Sicht steht Lenin für etwas, das der russische Staat und seine Ideologie gar nicht brauchen kann", sagt Leidinger. Zum heutigen Russland passt Stalin besser.
ntv.de: Aus dem Schulunterricht verbinden die meisten Deutschen und Österreicher mit Lenin vermutlich seine Fahrt 1917 aus dem Schweizer Exil mit der Eisenbahn durchs Deutsche Reich nach Russland, wo er dann die Revolution anführte. War die Oktoberrevolution ein deutscher Plan?
Hannes Leidinger: In gewisser Weise ja. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich gab es im Ersten Weltkrieg Überlegungen, wie man den Gegner von innen heraus destabilisieren könnte. Da dachte man nicht nur an Lenin und seine Bolschewiki, sondern grundsätzlich an alle oppositionellen Kräfte, die für Unruhe sorgen könnten. So wurden zum Beispiel auch ukrainische Separatisten von den Mittelmächten unterstützt. Aber Lenin ist kein deutscher Agent - das ist Blödsinn, eine Verschwörungstheorie. Für eine gewisse Zeit hat die deutsche Regierung dasselbe Interesse wie Lenin: Lenin will den Zarismus stürzen, und die deutsche Heeresleitung und die deutschen Regierungsstellen wollen den Krieg im Osten beenden.
War den Deutschen klar, dass sie damit ein Risiko eingehen?
Es war ein gefährliches Spiel, das war der Generalität klar, denn wer mit solchen Revolutionären zusammenarbeitet, muss damit rechnen, dass ihre Revolution auf Deutschland zurückfällt. Genau das war auch Lenins Ziel. Auf der anderen Seite sahen die Generäle und die Reichsregierung, dass Russland eine völlig andere Sozialstruktur hatte und die revolutionäre Bewegung in Russland nicht vergleichbar war mit den revolutionären Bewegungen in anderen Ländern. Die SPD im Deutschen Kaiserreich war in einer ganz anderen Situation als die Bolschewiki im zaristischen Russland.
Inwiefern?
Nehmen Sie Karl Kautsky, den österreichisch-deutschen Sozialdemokraten, den Lenin immer als großes Beispiel nennt, an dem er sich geradezu abarbeitet - zunächst kritisch-positiv, bis es später zur Auseinandersetzung kommt. Auch Kautsky steht für das revolutionäre Konzept, nicht für den Weg der Reformen. Aber was sagt Kautsky? "Wir sind eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei." Deutlicher hätte die deutsche Sozialdemokratie ihre Position nicht ausdrücken können.
In Russland operieren die Sozialdemokratie und die anderen oppositionellen Gruppen in einem verfassungsfreien Raum, in einem repressiven System, sind in die Illegalität gedrängt. Erst nach der Revolution von 1905 gibt es in Russland einen schwachen Pseudo-Parlamentarismus. Die deutsche Sozialdemokratie kommt hingegen nach dem Sozialistengesetz 1890 mitten in der Gesellschaft an. Ihre Leute ziehen in den Reichstag ein und sind für andere Parteien mögliche Partner späterer Entwicklungen. Natürlich wollen die alten bürgerlich-aristokratischen Eliten die Sozialdemokratie von der Regierung fernhalten. Aber es ist klar, dass hier eine neue Macht heranwächst. Die Situationen sind daher grundverschieden. Im einen Fall geht es um Legalität und einen Weg in die Mitte der Gesellschaft, im anderen um Illegalität, Randständigkeit und Gewalt.
Wie eng muss man sich Lenins Zusammenarbeit mit den Deutschen vorstellen?
Lenin will, dass das Zugabteil, in dem er und seine Gefolgschaft reisen, so gut als möglich abgegrenzt bleibt, gewissermaßen neutrales Gebiet. Zu den deutschen Generalstabsoffizieren hält er Distanz, mit ihnen spricht er nur über einen Vermittler, den Schweizer Sozialisten Fritz Platten. Durch Lenins Reise nach Russland bekommen beide Seiten, was sie wollen - aber eben nur für kurze Zeit. Man darf nicht vergessen: Als Lenin im April 1917 in Petrograd ankommt, befinden wir uns bereits im revolutionären Prozess, der Sturz des Zaren ist bereits vollzogen. Nach der Machtergreifung durch Lenin, die eigentlich eine Art Putsch ist, arbeiten die Bolschewiki mit allen Mitteln daran, auch deutsche Interessen durchzusetzen: den Frieden im Osten herzustellen, auch wenn Russland im Frieden von Brest-Litowsk große Gebiete verliert.
Fast zur selben Zeit, im März 1918, beginnen sich die russischen Sozialdemokraten, die Bolschewiki, "Kommunisten" zu nennen. Gleichzeitig gründen sie die ersten internationalen Organisationsformen, aus denen später die Kommunistische Internationale entsteht. Mit anderen Worten: Sie schließen Frieden mit einer Macht, die sie stürzen wollen. Denn das langfristige Ziel Lenins ist nicht die Revolution in Russland allein, sondern die Weltrevolution. Und kein Land ist dabei für Lenin so wichtig wie Deutschland.
Ihrem Buch habe ich entnommen, dass der Waggon, in dem Lenin nach Russland fuhr, gar nicht verplombt war, wie man häufig hört.
Lenin hat sich von den Offiziellen des Deutschen Reichs distanziert, aber er war nicht isoliert. Überliefert sind Gespräche mit Arbeitern, die er auf seiner Fahrt durch Deutschland geführt haben soll. Aber klar ist: Diese Reise ist für Lenin kompromittierend. Von seinen Gegnern wird die Zusammenarbeit dann völlig übertrieben, denn, wie gesagt: Es war nur eine Partnerschaft auf Zeit. Endgültig endet sie am 13. November 1918, als die Bolschewiki den Vertrag von Brest-Litowsk annullieren. Ab diesem Zeitpunkt holt Lenin die Internationalisten, die Kriegsgefangenen und Emigranten zusammen und sagt: Fahrt ins Ausland, macht die Revolution, und macht sie vor allem auch in Deutschland.
War Lenin sich des Widerspruchs bewusst, dass seine revolutionäre Kaderpartei von großbürgerlichen und intellektuellen Berufsrevolutionären wie ihm selbst geführt wurde, nicht von Angehörigen des "Proletariats"?
Dessen war er sich bewusst. Lenin selbst kam aus einer Lehrerfamilie, in der Bildung eine große Rolle spielte. Aber das hat eine lange Tradition in der revolutionären Bewegung, vor allem in Russland. Die Bauern und die Arbeiter waren oft so weit von der Macht und von der Bildung entfernt, dass sie sich über die regionale Ebene hinaus kaum artikulieren und vernetzen konnten. Im 19. Jahrhundert sind es häufig die Gebildeten, die vom alten System abrücken und sich einer sozialrevolutionären Bewegung anschließen. Da kommen dann die Söhne von Gutsbesitzern und Popen, die Hochschüler, Studenten, und sprechen mit den Bauern in einer Sprache, die sie von ihren eigenen Gutsbesitzern kennen. Und was passiert? Die Bauern rufen die Polizei. Die revolutionären Gruppen bleiben also vor allem unter sich.
Sie schreiben, selbst angesichts einer Hungersnot, die 1920/21 bis zu fünf Millionen Menschen in Russland und in der Ukraine hinwegraffte, habe Lenin "weder nach Moral noch nach Mitgefühl" gefragt. Woher kommt eine solche Skrupellosigkeit?
Lenin war von Haus aus ein sehr kühler, berechnender Mensch. Er hat eigentlich niemanden wirklich an sich herangelassen. Selbst seine Frau Nadeschda Krupskaja war in erster Linie seine Sekretärin. Am Anfang ist Lenin ein braver Schüler, dann kommt die Hinrichtung seines Bruders Sascha, weil dieser an Anschlagsplänen gegen Zar Alexander III. beteiligt war. Der schon immer etwas antiseptische Typus wird jetzt hart, bis zu einem gewissen Grad auch rachsüchtig. Lenin mag die Natur, er kann Pflanzen bestimmen - aber auch in der Natur hat er oft Bücher dabei. Wenn er mit Leuten spricht, fragt er sich gleichzeitig, ob das der Revolution nutzt. Er hört sich eine Komposition von Beethoven an und sagt: Dieser Weichheit und Schönheit können wir uns nicht hingeben, denn die Menschen verdienen keine Umarmung, sie verdienen Schläge. Seine politischen Konzepte sind untrennbar mit Gewalt verbunden. Den Klassenkampf will er über einen Bürgerkrieg herbeiführen. Das kündigt sich bereits früh an. Schon in den 1890er-Jahren macht er in seinen Schriften klar, dass es nicht um individuellen Terror geht, also etwa um die Ermordung eines Ministers. Das bringt zu wenig. Lenin sagt: Wir müssen viel breiter denken. Er weiß, dass er die Bauern als Bündnispartner braucht, weil es so viele sind, 80 Prozent der Bevölkerung. Aber er sagt auch: Wenn sie an Privatwirtschaft und "kleinbürgerlichen Reflexen" hängen, dann müssen wir sie bekämpfen. Und es bleibt nicht bei der Theorie. Im Bürgerkrieg ist es Lenin, der befiehlt, Kulaken, Popen, Offiziere, Aristokraten und so weiter zu erschießen.
In seinem politischen Testament schreibt Lenin, die Partei solle sich überlegen, "wie man Stalin ablösen könnte". Hat Lenin erkannt, wie gefährlich Stalin war?
Lenin, der Lehrer, der alle belehrt und der alles besser weiß, hat keinen richtigen Nachfolger. Er traut niemandem, auch Trotzki nicht. Stalins Härte und Rohheit passen ihm gut. In Stalins Hände gibt er auch den Apparat, dem er ebenfalls misstraut. Aber immer, wenn er dem Apparat misstraut, schafft er noch einen Apparat, zur Kontrolle der Kontrolleure. Daraus entstehen Monster wie das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion, das Stalin zu Beginn der 1920er-Jahre unter Kontrolle bekommt. Stalin versteht sich zudem sehr gut mit der sowjetischen Geheimpolizei Tscheka. All diese Apparate will Lenin immer wieder verändern, bürokratisiert sie aber nur und verwandelt sie in Mittel der Repression. Als Lenin 1922 erkrankt, hat Stalin längst die besten Chancen, sein Nachfolger zu werden.
Aber warum wollte Lenin Stalin verhindern?
Das kann mit einer persönlichen Auseinandersetzung zu tun gehabt haben: Stalin soll roh gegenüber Nadeschda Krupskaja gewesen sein. Ein mindestens ebenso wichtiger Aspekt für den kalten, berechnenden Lenin ist etwas anders: seine Vorstellung von der Sowjetunion, die 1922 gegründet wird. Zwischen Lenin und Stalin ist umstritten, wie dieser multiethnische Raum organisiert sein soll. Stalin ist für eine zentralistische, Lenin für eine föderalistische Lösung. Man muss dabei aber vorsichtig sein: Wenn Lenin über die Selbstbestimmung der Nationen bis hin zur Loslösung spricht, dann hofft er, dass er diese Nationen über die Revolution wieder zurückholen wird. Am Ende ist es nur eine Frage der Taktik. Aber auch in taktischen und strategischen Fragen kann Lenin Abweichungen nicht ertragen. Sicher ist: Es gibt keinen tiefen Gegensatz zwischen Lenin und Stalin - es geht von Lenin zu Stalin weiter. Lenin stellt die Weichen und weist den Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Stalin ist, ob Lenin ihn mag oder nicht, ein guter Repräsentant dieses Weges.
Drei Tage vor Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine sagte Putin in einer TV-Ansprache, die Ukraine sei überhaupt erst vom bolschewistischen Russland geschaffen worden; er nannte Lenin den "Erfinder" der Ukraine. Ist da was dran?
Da ist was dran, aber es ist übertrieben. Die Ukraine hat natürlich eine ganz eigene Geschichte. Im 19. Jahrhundert entstehen Elemente eines nationalen ukrainischen Denkens, die sich an westlichen Entwicklungen orientieren und einen Nationalstaat anstreben. Ein erster Versuch, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen, scheitert bis 1922/23 - auch an den Interessen der anderen großen Mächte, nicht nur an Russland. Es ist richtig, dass die ukrainische Nationalbewegung noch schwach war. Aber zu sagen, dass die Ukraine Lenins Konzeption war, ist absurd.
Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, dass das Putin-Regime zwar an Lenin festhält, gleichzeitig aber Alexander III. - also dem Zaren, unter dessen Herrschaft Lenins Bruder hingerichtet wurde - auf der Krim ein Denkmal errichtete. Wie passt das zusammen?
Gar nicht. Für Putin ist Lenin keine Figur, die er besonders in den Mittelpunkt stellen will. Uns ist das aufgefallen, als wir 2017 mit russischen Historikern über eine gemeinsame Konferenz aus Anlass des 100. Jahrestags der Oktoberrevolution gesprochen haben. Da hat die russische Seite, wohl auf Einflüsterung des Kremls, vorgeschlagen, dass wir uns mit einem österreichischen Gesandten des 16. Jahrhunderts beschäftigen, der vom Kaiserhof der Habsburger nach Sankt Petersburg geschickt wurde. Über die Revolution sollte möglichst gar nicht gesprochen werden: Revolution ist Unruhe, Revolution ist Chaos, der Bürgerkrieg ist Zwietracht. Aus Putins Sicht steht Lenin für etwas, das der russische Staat und seine Ideologie gar nicht brauchen kann. Denn gefragt ist der starke Staat - also wird nicht auf Lenin zurückgegriffen, sondern auf die alten Reichsideologien aus dem 17. Jahrhundert. Der 7. November als Tag der Oktoberrevolution wurde abgeschafft. Stattdessen gibt es jetzt im November den "Tag der Eintracht" des Volkes, zudem steht die Armee im Mittelpunkt. Dazu passt Stalin sehr viel besser als Lenin. Auch, weil sich die Revolution explizit gegen Offiziere richtete. Zudem schwingt bei Lenin immer noch das Klischee vom deutschen Agenten mit. Das stimmt zwar nicht. Aber in Putins Russland sind die Fremden meist das Böse.
Historiker streiten gelegentlich, ob eher Personen oder Strukturen für historische Prozesse verantwortlich sind. Wie ist es mit der Oktoberrevolution: Hätte es die ohne Lenin gegeben?
Nein. Vor der Oktoberrevolution ist Russland pulverisiert, Macht ist nur noch ein Wort, geschrieben auf einem Zettel, der auf der Straße liegt. Dann kommt Lenin, hebt sozusagen den Zettel auf und sagt: Ich werde aus diesem Chaos das Neue formen. Zugespitzt gesagt: Ohne Lenin hätte es keine Oktoberrevolution gegeben, ohne Oktoberrevolution keine Sowjetunion, ohne Sowjetunion nicht das 20. Jahrhundert, wie wir es kennen. Lenin war das Gehirn, die Energie, die Vernetzung und die Realpolitik. Manchmal beliebt es der Geschichte, sich in einem Menschen zu verdichten, hat der Historiker Joachim C. Fest einmal unter Bezugnahme auf Leopold von Ranke gesagt. So war es auch hier.
Mit Hannes Leidinger sprach Hubertus Volmer