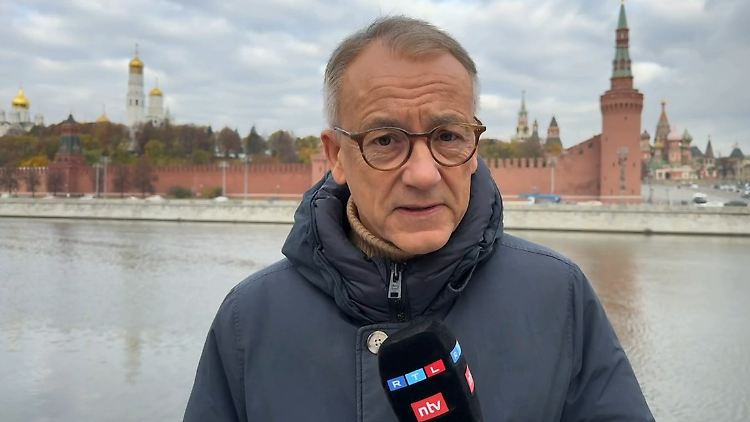Länder rechneten mit Milliarden Soli-Pläne der Union sorgen für Ärger
04.03.2015, 14:01 Uhr
Sigmar Gabriel gefallen die Pläne garnicht.
(Foto: imago/Stefan Zeitz)
15 Milliarden Euro kassierte der Bund 2014 aus dem "Soli". Nun will die Union den Zuschlag ab 2020 abbauen. Der Vorschlag ärgert nicht nur SPD und Linke, sondern vor allem die Länder. An anderer Stelle wird den Plänen zugejubelt.
Die Union geht in der Debatte über die Zukunft des "Solidaritätszuschlag" auf Konfrontationskurs mit der SPD sowie den meisten Bundesländern. Diese lehnen Pläne der Spitze von CDU und CSU ab, den "Soli" vom Jahr 2020 an schrittweise bis zum Jahr 2030 zu senken.
SPD-Chef Sigmar Gabriel zeigte sich von den Plänen enttäuscht. Auch in Ländern mit CDU-Regierungsbeteiligung stößt der Plan auf Widerstand. Länder und Kommunen hoffen, dass sie ab 2020 an den Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag beteiligt werden - was voraussichtlich zehn Milliarden Euro sein würden. Bisher fließen die "Soli"-Einnahmen von zuletzt 15 Milliarden Euro allein dem Bund zu.
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) erklärte, zum künftigen Umgang mit dem "Soli" mangele es nicht an Ideen. Für die Länder sei zentral, dass der Teil, der ab 2020 für Länderaufgaben vorgesehen sei - nämlich 42 Prozent des Aufkommens, nicht zur Disposition stehen könne: "Wir sind auch offen dafür, diesen Betrag zum Beispiel über gesteigerte Anteile an der Umsatzsteuer für die Länderaufgaben zu erhalten. Was der Bund in eigener Verantwortung für seinen Anteil entscheidet, ist dessen Sache."
Gabriel sagte der "Bild"-Zeitung, es sei schade, dass Merkel und Seehofer "dem klugen Rat" Schäubles nicht folgten. Grünen-Chefin Simone Peter erklärte, "den Soli einfach ersatzlos zu streichen", wäre "unklug und unsolidarisch". Sie plädierte erneut für die Finanzierung eines Altschuldentilgungsfonds.
Applaus aus der Industrie
Linken-Chef Bernd Riexinger warnte, es gebe genügend Beispiele klammer Kommunen. Das Geld aus dem "Soli" werde benötigt, um in die Infrastruktur zu investieren: "Ob der Soli weiter Soli heißt und in welcher Form er über 2019 hinaus bestehen wird, darüber kann man gern debattieren."
Unterstützung finden die Planspiele bei Industrie und dem Steuerzahlerbund (BdSt). Allerdings hält letzterer den Vorstoß für viel zu langsam. "Es ist richtig, dass die Union unseren Vorschlag endlich aufgreift, aber ihr Zeitplan ist absolut inakzeptabel", kritisierte BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Aufgeschoben sei in diesem Fall wie aufgehoben, legte der Anwalt der Steuerzahler nach.
Der "Soli" war 1991 als Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer eingeführt worden, um den Aufbau in den neuen Ländern bezahlen zu können. Mit einem Satz von heute 5,5 Prozent der Steuerschuld bringt er jedoch mehr ein, als die Ostförderung kostet. Mit dem offiziellen Ende beim "Aufbau Ost" im Jahr 2019 könnte der "Soli" aus Sicht Schäubles verfassungsrechtlich angreifbar werden.
Er hatte daher zunächst dafür plädiert, den "Soli" abzuschaffen und dafür die Einkommensteuersätze aufkommensneutral zu erhöhen. Dann hätte er sich die Einnahmen mit Ländern und Gemeinden teilen müssen. Eine Integration des "Soli" in die Einkommensteuer, ohne unterm Strich die Steuern zu erhöhen, gilt aber als schwierig. Merkel und Seehofer lehnten die Integration des "Soli" in die Einkommensteuer ab, da die Union vor der Wahl versprochen hatte, auf jedwede Steuererhöhung zu verzichten.
Quelle: ntv.de, bdk/dpa/DJ