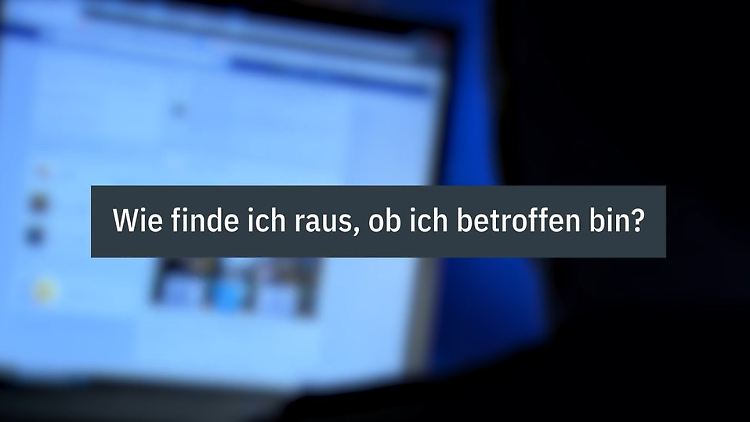Recht auf Kita-Platz Was können Eltern jetzt tun?
09.07.2013, 18:36 UhrViele Eltern in diesen Tagen eine Zitterpartie: Bekommen sie ab Herbst einen Kita-Platz für den Nachwuchs? Einen Anspruch darauf hätten sie. Doch schon jetzt ist klar, dass es nicht überall genügend Betreuungsplätze geben wird. Was dann?
Ab 1. August gilt der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz: Alle Eltern von ein- und zweijährigen Kindern müssen dann einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs bekommen, wenn sie es denn wollen. Die Städte, Kommunen und Gemeinden haben dafür sorgen, dass das klappt.

Drei bis sechs Monate vor dem ersten Geburtstag sollten Eltern mit der Suche nach einem Kita-Platz beginnen.
(Foto: dpa)
Drei Wochen bevor es losgeht, ist a llerdings schon sicher: Die vorhandenen Angebote werden nicht reichen. Nur wie groß die Lücken sind, ist noch unklar. Nach Einschätzung des Deutschen Städtetags fehlen bundesweit noch mehr als 100.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das Bundesfamilienministerium hält diese Zahl für überzogen. Die Länder hätten in den letzten Monaten Tempo gemacht und viele Plätze kurzfristig geschaffen. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) will an diesem Donnerstag aktuelle Zahlen präsentieren, die die Länder bis Ende Juni 2013 übermittelt hatten. Den Eltern dürften die Statistiken letztlich egal sein, solange die eigenen Kinder unterkommen. Aber wie stellt man das am besten an?
Wann und wo muss man Bedarf anmelden?
Zuständig sind die Kommunen, und hier in der Regel die Jugendämter. Alternativ kann man sich auch direkt mit den infrage kommenden Kitas in Verbindung setzen. Allzu lange sollte man damit aber nicht warten. Zwar gibt es keine verbindliche Frist für die Voranmeldung, generell gilt aber: je früher, desto besser. Spätestens Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn sollte der Antrag beim Amt sein.
Was passiert, wenn nichts passiert?
Manche Ämter sind überlastet. Manche haben aber auch einfach keine freien Plätze anzubieten, wollen das aber nicht formell einräumen. Schließlich ist es die Pflicht der Kommunen, genügend Plätze anzubieten. Gibt es nach drei Monaten immer noch keinen Bescheid, kann man Untätigkeitsklage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Manchmal reicht es aber auch schon, einen Anwalt zu beauftragen, dem Amt eine Frist zu setzen.
Was, wenn der Antrag abgelehnt wird?
Dann bleibt Eltern nur der Klageweg übers Verwaltungsgericht - in der Regel per Eilverfahren, schließlich drängt die Zeit. Einen Anwalt braucht man dafür nicht unbedingt, sofern man die Fallstricke kennt und den Antra g schlüssig begründen kann. Verliert man die Klage, dürfte das um die 700 oder 800 Euro kosten, schätzt der Fachanwalt Florian Linten. "Aber da der Anspruch so fest ausgestaltet ist, ist ein Verlust eigentlich kaum möglich." Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, sollte dort Unterstützung bekommen.
Droht den Kommunen jetzt eine Klagewelle?
Auch wenn diverse Kanzleien schon seit Monaten um prozessfreudige Eltern werben: Eine Klagewelle dürfte ausbleiben. "Dafür haben wir bis jetzt keine Anzeichen", so Städtetags-Hauptgeschäftsführer Stephan Articus. In Einzelfällen könne es zwar Klagen geben. "Da werden die Jugendämter sicher versuchen, sich mit den Eltern zu verständigen und andere Angebote zu machen, etwa für ganz kleine Kinder die früher sehr beliebten Krabbelgruppen."
Haben Eltern ein Recht auf Schadenersatz?
Kann die Kommune partout keine Betreuung organisieren, müssen Eltern womöglich auf teurere private Einrichtungen ausweichen. Ob sie in solchen Fällen Schadenersatz verlangen können, wird das Bundesverwaltungsgericht klären müssen. Präzedenzcharakter könnte ein Fall aus Mainz haben: Vor dem dortigen Verwaltungsgericht hat eine Mutter bereits erfolgreich auf Schadenersatz geklagt, weil ihr die Stadt keinen Kindergartenplatz zur Verfügung stellen konnte. Genau der ist aber vom Land Rheinland-Pfalz per Gesetz für alle Kinder über zwei Jahre garantiert – unabhängig von der bundesweiten Regelung.
Welche Betreuungsangebote müssen die Kommunen machen?
Ob die Kommunen Ganz- oder nur Halbtagsbetreuung anbieten müssen, ist bislang nicht geregelt. Da Kindergartenplätze für die Über-Dreijährigen nur halbtags vorgehalten werden müssen, dürfte das auch für Kita-Plätze gelten. Genaueres wird sich wohl erst aus der Rechtsprechung ergeben.
Ungeklärt ist bislang auch, ob die Kommunen auf eine Tagesmutter verweisen dürfen, wenn sie keinen Kita-Platz anbieten können. In der Praxis dürfte das des Öfteren vorkommen – und wird offenbar auch von vielen Eltern gerne angenommen, wie Städtetags-Chef Articus festgestellt hat: Zunächst habe der Städtetag das Interesse an der Tagespflege unterschätzt. "Mittlerweile nutzen aber viele Eltern diese Angebote ganz gerne, weil sie individueller und flexibler ausmachen können, wann sie ihr Kind bringen und holen."
Wie weit darf der Weg zur Kita sein?
Stehen genügend freie Plätze zur Verfügung, können sich die Eltern aussuchen, wo sie ihre Kinder unterbringen. Ansonsten müssen sie nehmen, was zu kriegen ist. Entscheidend ist dann nur, dass sie Kita in "angemessener Entfernung" zur Wohnung liegt. Das lässt allerdings Raum für Interpretationen. Mehr als eine halbe Stunde Anfahrt oder Fußweg dürften aber kaum zumutbar sein.
Ist der Kita-Platz kostenlos?
Kita-Plätze werden öffentlich gefördert, kostenlos sind sie aber in der Regel nicht. Der sogenannte "Elternbeitrag" wird von den jeweiligen Kommunen festgelegt. Eltern müssen aber in der Regel nicht so tief in die Tasche greifen, wie wenn sie ihr Kind privat unterbringen würden.
Quelle: ntv.de