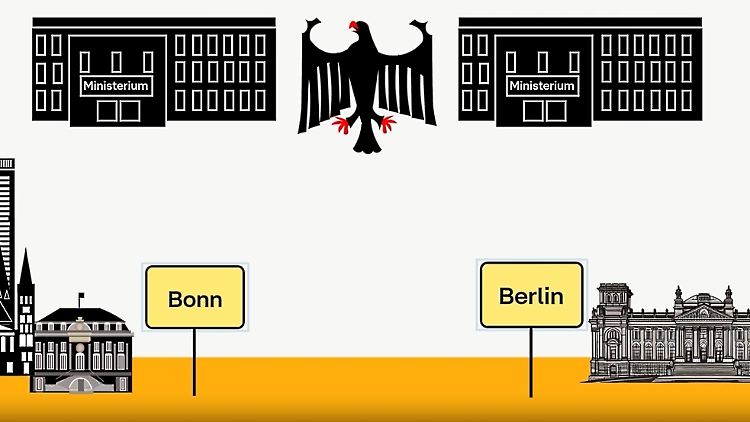Aus Angst vor der Wirtschaftsflaute verschieben immer mehr Chinesen ihr Geld ins Ausland.
(Foto: picture alliance / dpa)
Börsenbeben, gigantische Schulden und eine Währung im Sinkflug: Chinas Wirtschaftswunder kommt zum Erliegen. Immer mehr Chinesen bringen ihr Geld vor der Krise des Landes in Sicherheit.
Es klingt wie eine Wasserstandsmeldung für Devisenhändler in Hongkong, aber in Wahrheit ist es ein Warnsignal für die globale Wirtschaft. Die Zentralbank in Peking hat den Kurs der chinesischen Währung Yuan auf dem niedrigsten Niveau seit sechs Jahren festgelegt. Die massiven Wirtschaftsprobleme des Landes lassen sich daran so deutlich ablesen wie nie.
Frei gehandelt wird der chinesische Yuan noch immer nicht. Die Zentralbank koppelt ihn an den Dollar: Seit Jahren hält sie den Kurs mit massiven Verkäufen auf dem Devisenmarkt in einer engen Bandbreite. Diese künstliche Verbilligung der Währung ist Chinas wichtigste staatliche Exportförderung. Chinesische Produkte werden dadurch konkurrenzlos billig.
Die Parteiführung redet seit langem davon, ihr Yuan-Dumping zurückfahren und Chinas Währung mehr und mehr der echten Nachfrage des Marktes zu überlassen. Dass die Zentralbank nun zurückrudern muss und den Kurs sogar noch weiter drückt, zeigt, wie mies die Lage im Reich der Mitte ist. Immer mehr Anleger ergreifen deshalb die Flucht.
Zombie-Fabriken und Zitterbörsen
Ein riesiger Schuldenberg erdrückt die Wirtschaft. China steht inzwischen mit fast dem zweieinhalbfachen der gesamten Wirtschaftsleistung in der Kreide. Jahrelang hat die Parteiführung den Wirtschaftsboom mit billigen Krediten angeheizt. Doch nach fast zwei Jahrzehnten ungehemmter Expansion flaut das Wachstum ab. Inzwischen legt die Wirtschaft so langsam zu wie seit den frühen Neunziger Jahren nicht mehr. Sein offizielles Ziel hat Peking auf 6,5 bis 7 Prozent gekürzt. Doch selbst diese Zahl halten Experten noch für geschönt.
Tausende Zombie-Firmen hält die Regierung nur noch mit politisch motivierten Darlehen am Leben. Die Banken ächzen unter dem gigantischen Berg fauler Kredite. Erst am Montag verabschiedete die Regierung neue Regeln, nach denen die Geldhäuser ihre Kredite an marode Staatsbetriebe in Firmenanteile umwandeln können. Doch das löst das Problem nicht. Chinas Banken könnten bis 2020 bis zu 1,7 Billionen Dollar frisches Kapital brauchen, schätzt die Ratingagentur Standard & Poor's.
Schon mehrfach haben die Börsen in China deshalb mächtig gezittert. Im Sommer 2015 bekam Peking nur mit einer milliardenschweren Rettungsaktion für Broker und Finanzfirmen die Lage wieder in den Griff. Auslöser für den Crash war schon damals eine massive Abwertung des Yuan. Im Januar war die Finanzpanik so stark, dass der Handel mehrfach ausgesetzt werden musste.
Viele Anleger zweifeln offenbar daran, ob die Parteiführung den Druck der Marktkräfte auch künftig noch kontrollieren kann. Aus Angst vor einem neuen Börsenbeben und dem Wertverlust des Yuan verschieben immer mehr Chinesen ihr Geld ins Ausland.
Chinesen retten ihr Geld ins Ausland
Eine heimliche Kapitalflucht ist im Gange. Laut einer Analyse von Goldman Sachs flossen nach offiziellen Daten im August rund 28 Milliarden Yuan aus China ab. In den fünf Jahren zuvor waren es monatlich im Schnitt nur 4,4 Milliarden Yuan. Marktkräfte allein könnten den Exodus nicht erklären, heißt es in der Studie.
Immer mehr Unternehmen und Privatleute tauschen ihre Yuan-Vermögen in Dollar um. Der Druck ist so groß, dass die Regierung laut "Financial Times" bereits im Januar hinter vorgehaltener Hand verstärkte Kapitalkontrollen eingeführt haben soll. Chinesen dürften bei den Banken jährlich nur noch 50.000 Dollar kaufen, hieß es. Das hätten Aufseher mündlich verfügt.
Chinesische Firmen umgehen die Hürden offenbar, indem sie immer mehr überhöhte Rechnungen für Importe stellen. Die müssen bei ausländischen Lieferanten in Dollar bezahlt werden, folglich dürfen die Firmen dafür mehr Geld umtauschen. Ein Teil davon kommt aber nie bei den Geschäftspartnern an, sondern landet auf den eigenen Auslandskonten der Firmen.
Das flüchtende Geld hinterlässt offenbar bereits deutliche Spuren in Chinas Handelsbilanz. Laut "Bloomberg" sind Chinas Einfuhren aus Samoa im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 720 Prozent gestiegen. Die Importe aus den Bahamas zogen laut dem Bericht um über 350 Prozent an, die aus Hongkong um rund 130 Prozent und die Einfuhren aus den Cayman Islands legten um 76 Prozent zu. Womöglich sind all diese "Importe" in Wahrheit nichts weiter, als getarnte chinesische Geldtransfers in Steueroasen.
Die Kapitalabflüsse verstärken den Teufelskreis mit dem Chinas Wirtschaft kämpft. Denn je mehr Anleger ihr Geld ins Ausland verschieben, desto mehr wertet der Yuan ab. Die Zentralbank muss mit Aufkäufen gegensteuern. Noch droht keine Gefahr, dass die Währungshüter dabei die Kontrolle verlieren: Ihre Währungsreserven stehen momentan bei mehr als drei Billionen Dollar. Das ist allerdings der niedrigste Stand seit fünf Jahren. Und unbegrenzt sind sie nicht.
Quelle: ntv.de