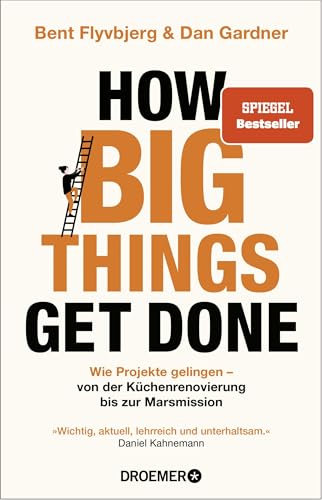Das Problem mit MegaprojektenWarum China AKWs bauen kann und wir nicht
 Von Christian Herrmann
Von Christian Herrmann
In Europa und den USA endet jedes neue Atomkraftwerk im Desaster. China dagegen baut problemlos ein neues nach dem anderen. Wie kann das sein? China hat ein Atomprogramm ohne Stop-and-Go-Historie und benötigt für neue AKW-Projekte keinen "Schönheitswettbewerb".
Während andere Länder vom Bau neuer Kernkraftwerke träumen, zieht eine Nation davon: China hat sein erstes AKW erst 1981 genehmigt. Seitdem sind 57 Reaktoren in Betrieb gegangen. 30 weitere werden derzeit gebaut. 2022 und 2023 wurden jeweils zehn neue genehmigt, wie aus dem Bericht zum Zustand der weltweiten Atomwirtschaft (WNISR) hervorgeht. Am Montag erhielten elf weitere Reaktoren grünes Licht.
Macht China in diesem Tempo weiter, könnte es laut einer Schätzung 2030 die USA überholen und die weltweit größte Atomnation werden: Die Vereinigten Staaten betreiben derzeit 94 Kernreaktoren. Anders als die Volksrepublik hat der Klassenprimus seit 1996 allerdings nur drei neue ans Netz genommen.
Doch China ist die Ausnahme, nicht die Regel: Anderswo scheitern Staaten und Unternehmen regelmäßig am Bau und am Betrieb von Kernkraftwerken. Zwar sind weltweit 407 Reaktoren in Betrieb. Gleichzeitig wurden bereits 214 stillgelegt. 34 sind einsatzfähig, erzeugen aber seit mehr als 18 Monaten keinen Strom mehr. 93 Bauprojekte wurden abgebrochen. "Die Industrie weiß, dass sie den Bau standardisieren muss, aber trotz vieler Versuche ist sie nicht in der Lage, Kernenergie im Plan und zu niedrigen Kosten zu liefern", umschreibt der dänische Ökonom Bent Flyvbjerg das große Problem. "Und jetzt sind Windkraft und Solarenergie so wettbewerbsfähig geworden, dass die teure Kernenergie hoffnungslos veraltet aussieht."
"Das ist unglaublich!"
Bent Flyvbjerg untersucht und lehrt an den Universitäten Kopenhagen und Oxford "Major Program Management", also das Management von großen und teuren Projekten wie Flughäfen, Staudämmen oder Kernkraftwerken. Die Daten trägt der Däne seit mehr als 20 Jahren zusammen, mehr als 22.000 Projekte wurden inzwischen erfasst. In seinem Buch "How Big Things Get Done" hat er erstmals die wichtigsten Erkenntnisse veröffentlicht. Der Bau der meisten Großprojekte endet im Fiasko, fasst er im ntv-Podcast "Wieder was gelernt" zusammen: "90 Prozent der Projekte gehen Geld und Zeit aus, bevor sie fertiggestellt sind", sagt Flyvbjerg. "Das ist die Realität, die in unseren Statistiken deutlich wird. Das ist unglaublich!"
Zu den größten Übeltätern gehört den Daten zufolge die Atomindustrie. Kernkraftwerke werden im Schnitt 120 Prozent teurer als geplant. End- oder Zwischenlager kosten sogar 238 Prozent mehr, als ursprünglich veranschlagt wurde. Von allen erfassten Großprojekten schneiden nur die Olympischen Spiele ähnlich schlecht ab: Sie werden im Schnitt 157 Prozent teurer.
Die Ursache ist schnell gefunden. Kernkraftwerke sind eine maßgeschneiderte und komplexe Technologie mit einem ebenso großen wie einzigartigen Kostenfaktor: dem Schutz vor einem Super-GAU. "Ob Three Mile Island, Tschernobyl oder Fukushima - nach jedem Zwischenfall haben die Aufsichtsbehörden die Sicherheitsvorschriften angepasst", sagt Flyvbjerg. "Das bedeutet natürlich, dass es immer schwieriger wird, ein Kernkraftwerk zu bauen."
Jahrzehnte ohne neue Reaktoren
Nicht alle Staaten haben ihr Atomprogramm - wie Deutschland - nach der Kernschmelze im japanischen Fukushima eingestellt, aber selbst Länder wie die USA kamen ins Grübeln. Bis heute haben die Vereinigten Staaten bereits 42 AKW im Bau abgebrochen. Nach der Katastrophe von Tschernobyl sind lange Lücken im Atomprogramm erkennbar. Als 1996 im Bundesstaat Tennessee der Reaktor Watts Bar 1 ans Netz ging, war es für mehr als 20 Jahre der letzte neue in den USA. Erst seit einigen Jahren gewinnen neue Projekte aufgrund des Klimawandels und des steigenden Energiebedarfs in den USA, Frankreich und anderen Atomnationen wieder an Zuspruch.
Doch dieses Stop-and-Go-Verfahren hat der Branche zugesetzt: Abläufe und Verfahren sind über die Jahre eingerostet, Lieferketten zusammengebrochen, fähige Ingenieure und Facharbeiter haben den Job gewechselt. Das Ergebnis zeigt sich bei den wenigen aktuellen Projekten: Kosten explodieren, Zeitpläne implodieren. Die strengeren Sicherheitsvorschriften können in neueren Kernkraftwerken offensichtlich nur mit gefälschten Zertifikaten eingehalten werden. Das betrifft in Frankreich etwa Schweißnähte, in Südkorea mehrere Tausend Bauteile.
Bankrotte Industrie
Dieses Risiko war den Strategen in Peking offenbar bewusst. Anders als westliche Länder weist die Volksrepublik seit Beginn ihres Atomprogramms in den 80er-Jahren null abgebrochene Projekte vor. China ist das einzige Land, das den Bau neuer Reaktoren nach der Katastrophe von Fukushima nicht eingestellt hat. "Wenn man den Bau neuer Anlagen stoppt, hinterlässt man ein Erfahrungsvakuum oder eine bankrotte Industrie", sagte ein Atomexperte vor Kurzem im Wirtschaftsportal Bloomberg.
Auf diese Weise hat das chinesische Atomprogramm jene Standardisierung erreicht, die in Europa und den USA inzwischen fehlt. Die Branche verfügt über einen großen Pool an erfahrenen Arbeitskräften, einheitlichen Reaktortypen, etablierten Lieferketten und staatlichen Banken als zuverlässige Geldgeber.
Das "Window of Doom"
Doch Bent Flyvbjerg sieht ein weiteres Problem. Gerade, weil neue Atomprojekte in Europa und den USA umstritten und als Kostenfallen bekannt sind, müssen Befürworter sie auf dem Papier besonders attraktiv aussehen lassen. Es kommt zu einer "strategischen Falschdarstellung", sagt der dänische Ökonom. Der Nutzen wird übertrieben dargestellt, die Kosten möglichst gering. Risiken werden einfach ausgeblendet.
Doch sobald die Arbeiten beginnen, schlägt die Realität zu und das "Window of Doom" öffnet sich: Auf der Baustelle muss korrigiert werden, was bei der Planung aufgehübscht oder ignoriert wurde. Je länger dies dauert, desto mehr kann schiefgehen. Leitzinsen, Ölpreise, Kriege, Naturkatastrophen - Komplikationen warten überall.
"Es dauert ewig, ein Kernkraftwerk zu bauen. Zehn oder 15 Jahre sind keine Seltenheit", sagt Flyvbjerg. "Das ist ein riesiges 'Fenster des Verderbens', durch das alle möglichen Dinge durchfliegen können. Die meisten Menschen halten das Risiko einer Pandemie für sehr gering, aber statistisch gesehen, gibt es mindestens eine pro Jahrhundert. Wenn man also 15 Jahre braucht, um ein Kernkraftwerk zu bauen, liegt das Risiko einer Pandemie während des Baus bei 15 Prozent!"
Rettung und Pleiten
Das "Window of Doom" ist westlichen Atomunternehmen bestens bekannt: Die französische EDF ist hoch verschuldet und musste vor wenigen Jahren vom Steuerzahler gerettet werden. Die Amerikaner von Westinghouse sind am Bau der neuesten amerikanischen Atomkraftwerke pleitegegangen.
Dennoch wollen die USA und 21 weitere Staaten ihre Atomkapazitäten bis 2050 verdreifachen und mehr als 1000 neue Atomkraftwerke bauen. Bent Flvybjerg ist skeptisch. Er glaubt nicht, dass sie den Bau von Atomkraftwerken rechtzeitig in den Griff bekommen, sodass sie im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Dennoch würde er der westlichen Atomindustrie noch eine Chance geben - wenn sie es wie China schafft, ihre Projekte zu standardisieren. Ansonsten werden sie ihre Spitzenplätze in der Katastrophen-Liste sicher verteidigen.