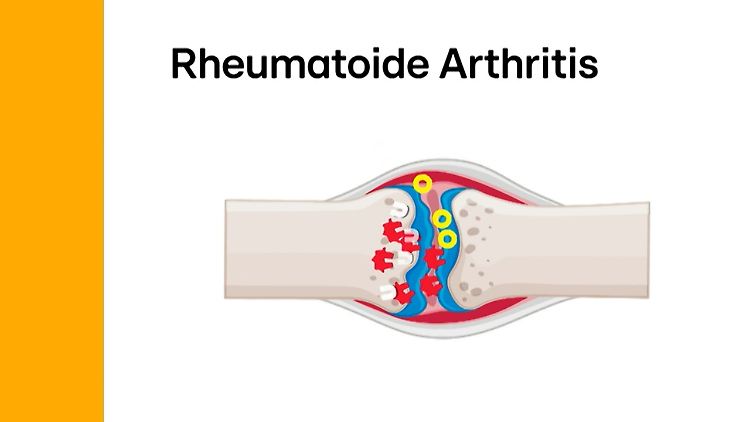Klima wandelt Landschaften Palmen statt Schnee
18.09.2007, 10:03 Uhr
Grüne Wiesen statt Skipisten im Winter, ausgetrocknete Felder und versiegende Bäche im Sommer: Der Klimawandel wird die Landschaft in Deutschland sichtbar verändern. Süddeutschland ist besonders betroffen. Dort wird den Prognosen nach in den kommenden 50 Jahren die Temperatur mit rund 1,7 Grad stärker steigen als in anderen Landesteilen.
In 100 Jahren gehen Schätzungen für Süddeutschland sogar von einer Erwärmung um bis zu 4 Grad aus. Wissenschaftler sehen hier aber noch Spielraum. "Die erste Hälfte des kommenden Jahrhunderts ist programmiert - bei der zweiten Hälfte muss man noch eine ganze Serie von Fragezeichen setzen - weil dann wirkt, was wir in den nächsten 50 Jahren tun werden", sagt der Vorsitzende des Bayerischen Klimarates, Hartmut Graßl.
Neue Herausforderungen und Chancen
Gra ßl, der früher das Klimaforschungsprogramm der Weltwetterorganisation leitete, sieht die Hauptprobleme des Klimawandels außerhalb Europas. "Diejenigen, die ihn nicht verursacht haben, sind die Hauptleidtragenden - diejenigen, die ihn verursacht haben, wollen in Saus und Braus weiterleben, während die anderen in Massen fliehen müssen, weil es kein Wasser mehr gibt." Schon jetzt müssten Einwanderungsprogramme aufgelegt werden. "Man muss die Immigration organisieren: Es muss globale Abkommen dazu geben, weil man vieles nicht mehr verhindern kann." Es könne nicht angehen, dass sich Europa vor Flüchtlingen mit "Elektrozaun" schützt.
Die Klimaerwärmung läuft schon jetzt vier Mal schneller als im vergangenen Jahrhundert. An den bayerischen Seen könnte es somit bis Mitte des 21. Jahrhunderts Palmen und Zitronenbäume geben wie am Gardasee und am Lago Maggiore - mit einer strukturellen Neuausrichtung für Tourismus und Landwirtschaft, so Bayerns Umweltminister Werner Schnappauf (CSU). In Norddeutschland werde Weinbau möglich sein.
Trinkwasserprobleme und Schutthalden
Im Alpenraum steigt die Temperatur besonders schnell. Schon in den vergangenen 50 Jahren war dort die Erwärmung mit 1,2 Grad doppelt so hoch wie weltweit. Denn mit dem Anstieg der Schneefallgrenze und weniger schneebedecktem Boden wird die Sonnenenergie nicht mehr so stark zurückgestrahlt. Heute falle noch ein Drittel der Niederschläge als Schnee, Ende des Jahrhunderts werde es nur noch ein Sechstel sein, sagt Schnappauf. "Daran zeigt sich, wie stark sich das Ökosystem verändert."
Vor allem die Winter werden wärmer - und nässer: Die Niederschläge werden den Prognosen zufolge dann regional um bis zu 35 Prozent zunehmen, wie der Hydrologe Alexander Kleinhans vom Landesamt für Umwelt erläutert. Die Folgen: Hochwasser und Murenabgänge. Im Sommer wird es trockener - vor allem nach Osten hin in den neuen Ländern. "Ich gehe davon aus, dass es dort Trinkwasserprobleme geben wird", sagt Kleinhans.
Anstelle der Gletscher werden sich im Hochgebirge Schutthalden erstrecken. In den Ostalpen, darunter die Tauern, wird es schon in 50 Jahren fast kein "ewiges Eis" mehr geben. "Es schaut alles nicht mehr so schön aus", sagt Graßl. Die Baumgrenze steigt, die Fichten sterben in unteren Regionen ab - schon jetzt sind sie vielerorts von Schädlingen befallen und müssen gefällt werden. Offen ist, ob Aufforstungsprogramme mit Laubbäumen den Wald dauerhaft erhalten können.
Auch Krankheiten wie Denguefieber und Westnilfieber könnten sich hierzulande ausbreiten. "Es ist klar, dass bestimmte Infektionskrankheiten aggressiver werden", sagt Graßl. Malaria werde angesichts der guten Gesundheitsvorsorge nicht geben.
Fehlende Lebensgrundlage
Mal zu trocken und warm, mal zu nass und kalt: Die Wetterkapriolen machen auch den Bauern zu schaffen. Bauernpräsident Gerd Sonnleitner verlangt deshalb längst eine bessere Unterstützung der Forschung, um mit einer Anpassung der Anbaumethoden und Neuzüchtungen auf den Wandel reagieren zu können.
Für den Meteorologen und Klimaexperten Graßl bleiben die hiesigen Sorgen über den Klimawandel gemessen an den Folgen in anderen Teilen der Erde geringfügig. "Es wird hunderte Millionen Menschen geben, denen die Lebensgrundlage entzogen wird. Das ist das Problem und nicht ein paar Zitronenbäume am Chiemsee."
Quelle: ntv.de, Sabine Dobel, dpa