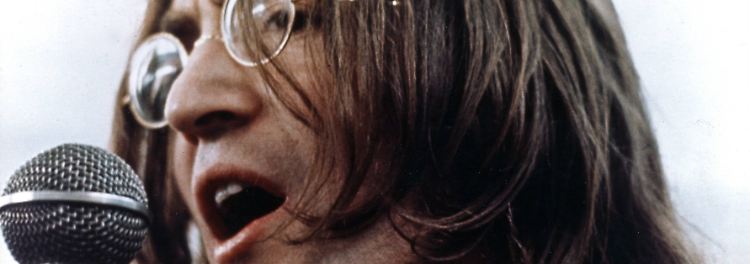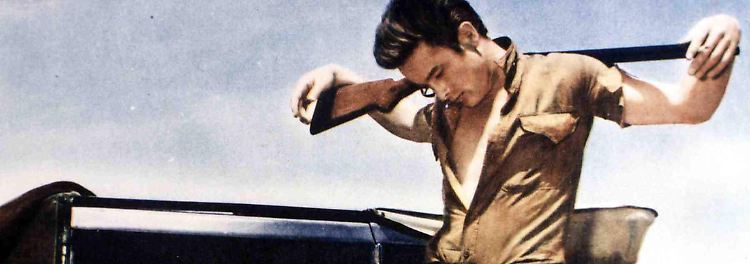Surreal, aber nicht weltfremd Kafka wurde vor 125 geboren
03.07.2008, 10:04 UhrDreimal Goethes Gartenhaus: Akkurat gestickt von Franz Kafkas zweimaliger Verlobter Felice Bauer. Sorgfältig skizziert von Max Brod, Kafkas Freund, späterem Testamentsverweigerer und Herausgeber. Und schließlich gezeichnet von Kafka selbst, weder akkurat noch sorgfältig, sondern verfremdet und irgendwie beunruhigend. Kafka verunsichert - mit seinen Zeichnungen, mit dem ernsten, intensiven Gesichtsausdruck auf den Fotos, vor allem mit seiner Literatur. Vor 125 Jahren, am 3. Juli 1883, wurde der Schriftsteller geboren; er starb im Alter von 40 Jahren 1924.
Beschaulichkeit lag Kafka nicht. "Die Leser von anheimelnder Literatur sind bei ihm schlecht aufgehoben", sagt der Kafka-Kenner, Publizist und Verleger Klaus Wagenbach, aber anheimelnd müsse Literatur ja auch nicht sein. Das fand auch Kafka. "Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? (...) Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns", schrieb er in einem Brief.
Verstörende Geschichten
Kafka hat uns so manche Axt geliefert. "Die Verwandlung" zum Beispiel, in der Gregor Samsa erwacht und sich in ein Ungeziefer verwandelt findet. "Das Urteil", in einer einzigen Nacht geschrieben, über einen Vater, der seinen Sohn zum Tod durch Ertrinken verurteilt. Kafka erfand den Affen, der über seine Menschwerdung berichtet. Und er schrieb winzige Geschichten, hochverdichtet und meist verstörend, wie der eine Satz: "Ein Käfig ging einen Vogel suchen."
Franz Kafka, das älteste Kind einer deutschsprachigen jüdischen Kaufmannsfamilie, wurde in Prag geboren. Das Leben der Kafkas war geprägt vom "Geschäft", in dem Schirme, Spazierstöcke, Handschuhe, und andere "Galanteriewaren" verkauft wurden. Es bescherte den Lebensunterhalt und den allmählichen sozialen Aufstieg. Kafka wirkt wie eingeklemmt in dieses Leben. Schreibtisch und Bett standen im bescheidenen Durchgangszimmer zwischen dem Elternschlafzimmer und der guten Stube. Seine drei Schwestern teilten sich einen Raum.
Zwei Leben
Nach dem Abitur studierte Kafka Jura. Für einen Moment lag zwar die Idee der Befreiung in der Luft, ein Germanistikstudium in München nämlich. Aber er blieb doch in Prag und promovierte, knapp 23 Jahre alt, zum Doktor juris. Da hatte er längst zu schreiben begonnen, die "Beschreibung eines Kampfes" und die "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande". 1908 veröffentlichte er die ersten Prosastücke in einer Zeitschrift, 1912 schrieb er "Das Urteil" und "Die Verwandlung", und 1913 kam das Bändchen "Betrachtung" heraus. Zugleich machte er Karriere als Jurist bei der "Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt".
Zwei Leben: Von 8.00 bis 14.00 Uhr befasst sich Kafka mit Arbeitsunfällen in Fabriken und wie sie zu verhindern wären. Er plädiert für die Einführung runder Wellen in Hobelmaschinen statt der gefährlichen Vierkantwellen und schlägt sich mit Fabrikanten herum, die sich gegen die Versicherungsbeiträge wehren. Und nachts, wenn die Wohnung endlich ruhig geworden ist, schreibt er seine Geschichten.
Sprache als Lebensstoff
Welches Leben sein eigentliches ist, steht für ihn fest, aber seinen Eltern hätte er es nie begreiflich machen können: "Er hat das Bewusstsein gehabt, dass er in der Sprache lebt. Die Sprache war sozusagen sein Sauerstoff, sein Lebensstoff", sagt sein Biograf Reiner Stach. Schreiben war seine Berufung, fast eine Sucht.
Briefe schreibend liebte Kafka Felice und litt zugleich unter der Angst, als Ehemann und Vater, in einer bürgerlichen Existenz, nicht mehr schreiben zu können. Ein Schriftsteller "darf sich eigentlich, wenn er dem Irrsinn entgehen will, niemals vom Schreibtisch entfernen, mit den Zähnen muss er sich festhalten", schrieb Kafka.
Etwas, das unter die Haut geht
Mit seiner Sprache schuf er Welten und Geschichten, die oft als surreal bezeichnet werden, als traumhaft, unwirklich. Aber Kafkas Geschichten müssen etwas sehr Reales haben, sonst gingen sie nicht so vielen Menschen unter die Haut, von Europa bis Japan, von 1908 bis heute. "Das kann nur bedeuten, dass die Schicht, die er da anspricht in uns, tiefer liegt als die kulturellen Prägungen", sagt Stach. Kafka deute auf den Schrecken, zeige ihn aber nicht - und biete damit eine leere Fläche, auf der wir unseren eigenen Schrecken sehen.
Kafka war nicht weltabgewandt. Er wusste, wie Arbeiter leben, und die Bedingungen in der Asbestfabrik seines Schwagers, an der er durch eine Investition seines Vaters beteiligt war, schildert er im Tagebuch. Seine Literatur speist sich aus der Wirklichkeit, aber er befreit sie vom Alltäglichen. Die Probleme, die er thematisiert, sind zeitlos: Selbstzweifel, Bindungsangst, Angst, das Leben zu verpassen.
Hin- und Hergerissensein als Leitmotiv
Damit kannte er sich aus. Dreimal war er verlobt, schreckte aber vor der Heirat zurück. Vom "Verlangen nach Menschen, das ich habe und das sich in Angst verwandelt, wenn es erfüllt wird", schreibt er in einem Brief. Dieses Hin- und Hergerissensein ist ein Leitmotiv. Kafka wollte weg aus Prag, blieb aber bis kurz vor seinem Tod. Er hasste das "Erwerbsleben" - und war der Versicherung 14 Jahre lang treu.
Die Literatur, in die Kafka seine Konflikte verwandelte, fesselt nach Ansicht Wagenbachs aus drei Gründen: "Einmal die ganz klare Sprache. Zweitens diese fantastische Welt, die mit überraschenden Dingen angefüllt ist, aber in unserer Welt handelt. Und drittens die Bilder der Macht. Das sind natürlich Bilder, die man nie vergisst."
Prophetische Gaben
Stach spricht von der "Angst vor anonymen Lebensmächten", die Kafka thematisiert, Angst vor dem Gericht, vor dem Gesetz, vor den Herren im Schloss. Manche sehen hier gar prophetische Gaben angesichts des Schreckens, der noch bevorstand - Kafkas Schwestern wurden zwei Jahrzehnte nach seinem Tod von den Nazis ermordet.
Aber Stach weist darauf hin, dass Kafka nicht in eine dunkle Zukunft schauen musste, um besorgt zu sein. Die Schrecken des Weltkriegs waren ihm bewusst, das Zusammenbrechen der alten staatlichen Strukturen, der Zusammenprall von Mensch und Maschine, die doppelte Bedrohung durch Deutschenhass und Judenhass in Prag.
Scheitern an der großen Form
1917 erkrankte Kafka an Tuberkulose, 1922 konnte er nicht mehr arbeiten und wurde pensioniert. Es war fast, als ob ihn die Krankheit von allen Ansprüchen an ein bürgerliches Leben befreie. Er zog nach Berlin, lebte mit seiner letzten Liebe Dora Diamant zusammen, bis er in die Klinik musste. Am 3. Juli 1924 starb er in Kierling bei Wien.
Souverän beherrschte Kafka präzise Erzählungen und Geschichten. Seine sieben veröffentlichten Bücher ließ er im Testament gelten. Dass er alles habe vernichten wollen, ist ein großes Missverständnis - noch auf dem Sterbebett arbeitete er an den "Hungerkünstler"-Druckfahnen. Was ihn schmerzte, war das Scheitern an der großen Form, das Abbrechen der Romane "Der Prozess", "Das Schloss" und Amerika". Die bat er Brod zu vernichten, auch Briefe und Tagebücher. Dass der Freund diese Bitte vielleicht nicht erfüllen würde, mag Kafka geahnt haben. Dass seine Werke zu Welterfolgen werden würden, sicher nicht.
Von Jürgen Hein, dpa
Quelle: ntv.de