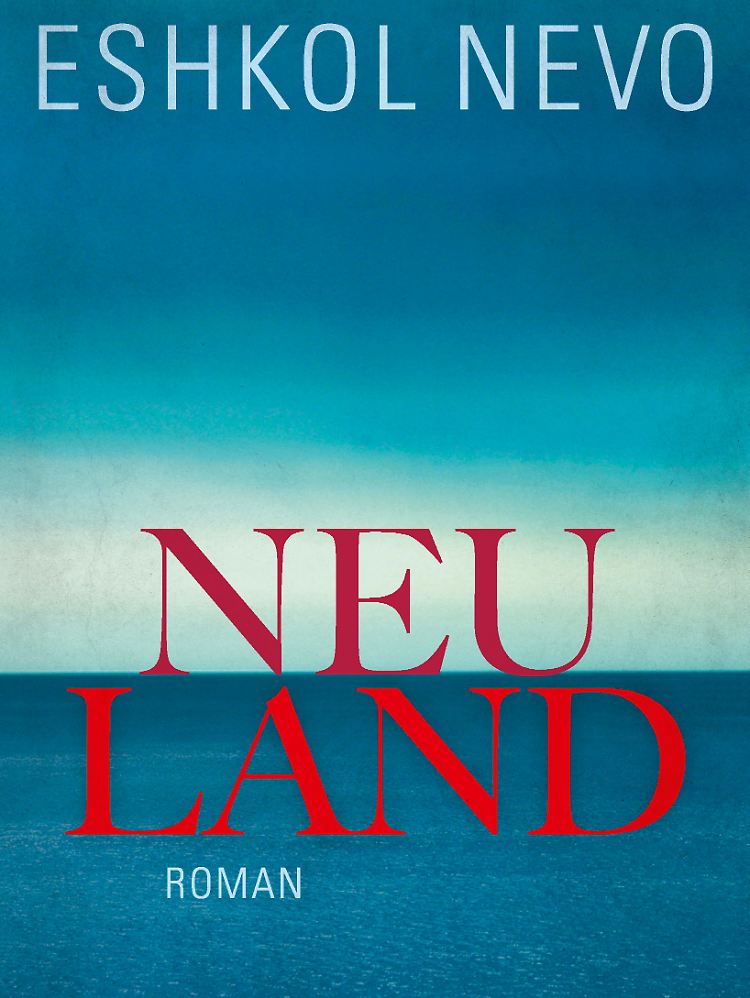"Schlage einen anderen Weg ein" Auf der Suche nach "Neuland"
07.10.2013, 13:28 Uhr
Werbung für Deutschkurse des Goethe-Instituts auf einem Bus in Tel Aviv: Das Berlin-Fieber wird in Israel heftig diskutiert.
(Foto: picture alliance / dpa)
Dass Angela Merkel für "Neuland" Werbung macht, freut Eshkol Nevo besonders. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt wie der israelische Autor der Frage nachgehen will, ob man auf dem Pfad bleiben oder seinem Herzen folgen sollte.
Neuland
Dori will nicht fliegen. Er will zu Hause bleiben, seinen kleinen Sohn Neta beim Schlafen beobachten, den Geruch von Ohne-Tränen-Shampoo und warmer Milch mit braunen Zucker einsaugen. Was hat er in Südamerika zu suchen? Seinen offenbar verrückt gewordenen Vater, der den Tod der Mutter schlechter verkraftet, als Dori und seine Schwester es je von diesem selbstbewussten, gutaussehenden Mann erwartet hätten. Meni Peleg, Veteran des Yom-Kippur-Krieges, Unternehmensberater, bricht am Grab seiner Frau zusammen. Und flieht anschließend nach Südamerika, um dort "Neuland" zu finden. War er womöglich suizidgefährdet? Das wäre eine bessere Erklärung als die Vorstellung, dass sein Vater als eine Art "Guru" eine Parallelgesellschaft für traumatisierte israelische Ex-Soldaten aufbaut. Dieser Meni ist Dori fremd. Doch die Sorge und die Pflicht eines Sohnes treibt ihn an den Flughafen. Auch auf die Gefahr hin, das sein eigener sensibler Sohn durch seine Abwesenheit Schaden nimmt, oder die Kluft zu seiner Frau Roni, die er hoffnungslos liebt, noch tiefer wird.
Inbar hält dagegen wenig zu Hause. Ihren Job bei einer Radio-Ratgebersendung hat sie hingeworfen. Ihre Familie ist nach Tod ihres Bruders auseinandergebrochen. Der Vater lebt mit neuer Frau und Kind in Australien, die Mutter bei ihrem neuen Lebensgefährten in Berlin. Ihren Freund Ejtan mag Inbar, aber reicht das, um eine Familie zu gründen? Nur Großmutter Lilli hält sie noch – wem soll Lilli morgens ihre Träume erzählen, wenn nicht ihrem Feuervogel, ihrer Tsipke Fayer? Doch vielleicht kann ein kurzer Besuch in Berlin wenigstens einige Dinge mit ihrer Mutter wieder gerade rücken. Berlin stürzt Inbar jedoch in noch größere Lebenszweifel. Aber wer nicht weiß, wo er hingehört, kann genauso gut in das nächste Flugzeug nach Südamerika steigen. Der Zufall führt Dori und Inbar in Peru zusammen und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Meni. Werden auch sie "Neuland" finden?
"Kannst du dir vorstellen, dass du einen anderen Weg einschlägst? In Sachen Familie, Liebe. Und im weiterem Sinne: Kannst du dir vorstellen, dass dein Land sich anders entwickelt?" Das seien die Fragen gewesen, die er sich beim Schreiben gestellt habe, erzählt Eshkol Nevo. Doch bevor er weitere Fragen beantwortet, holt er zur Feier des Tages erstmal Orangensaft und Kaffee vom Frühstücksbuffet des Hotels und baut alles auf dem Tisch auf. "Das ist hier nämlich mein erstes Interview zu 'Neuland' in Deutschland!"
Draußen ist es kalt und regnerisch, der Temperaturunterschied zu Tel Aviv hat ihm umgehend eine Erkältung beschert, aber trotzdem ist der israelische Autor glänzend aufgelegt. Nach "Vier Häuser und eine Sehnsucht" und "Wir haben noch das ganze Leben", ist "Neuland" das dritte Buch, das Nevo hierzulande präsentiert und diesmal ist er besonders gespannt auf die Reaktionen. Denn erstmals schickt er seine Romanfiguren aus Israel hinaus in die Welt, nach Ecuador, Peru, Argentinien. Und nach Deutschland. Nach Berlin.
Das Buch müsse hier einfach ein Erfolg werden, denn wie ihm zu Ohren gekommen sei, mache immerhin Angela Merkel höchstpersönlich Werbung für ihn, lacht Nevo in Anspielung auf den im Zusammenhang mit der NSA-Affäre getätigten Ausspruch der Bundeskanzlerin, beim Internet handele es sich schließlich um "Neuland". Das Vergnügen daran, dass man sein Buch hier mit einem Beitrag zur NSA-Debatte verwechseln könnte, lässt sich der Autor nicht nehmen. Auch nicht, als er später bei der Lesung auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin ganz ernsthaft darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Begriff "Neuland" hierzulande nur ein Synonym für unbekanntes Terrain sei und nicht automatisch an den Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, und sein Buch "Alt-Neuland" gedacht werde.
Auch ihm sei es nicht nur um die Frage gegangen, wohin sich der Zionismus entwickelt, obwohl der Titel tatsächlich auf das berühmte Herzl-Werk anspiele, erklärt Nevo im Interview. Sicher tue es weh, wenn man die sozialen Ideen Herzls mit dem kapitalistischen System vergleiche, das heute in Israel vorherrsche, "Aber ich glaube nicht, dass das für Menschen außerhalb von Israel wirklich interessant ist."
Dagegen habe sich wohl schon jeder einmal die Frage gestellt, was gewesen wäre, wenn man sich in dem einen oder anderen Moment anders entschieden hätte. Wenn man an der Gabelung doch den nicht eingeschlagenen Weg genommen hätte. "Das Buch ist keine Aufforderung, über die Probleme in Israel nachzudenken, sondern eine Einladung, darüber zu sinnieren, wie man sein Leben anders leben könnte."
Ambivalente Liebe

Eshkol Nevo wurde unter anderem mit dem Golden Book Prize 2005 sowie dem Raymond-Wallier-Preis des Pariser Salon du Livre 2008 ausgezeichnet. Er lehrt an israelischen Universitäten Kreatives Schreiben.
Vor sechs Jahren, als Nevo sein erstes ins Deutsche übersetzte Buch "Vier Häuser und eine Sehnsucht" in Berlin vorstellte, war die Stadt für ihn noch unbekanntes Terrain, und zwar eines, das ihm zu schaffen machte. Die deutsche Sprache zu hören, Orte zu besichtigen, die im Zusammenhang mit der deutsch-jüdischen Geschichte stehen, fiel ihm schwer. Mittlerweile ist er zum sechsten Mal in Berlin und gibt zu, nicht genug von der Stadt bekommen zu können: "Ich sollte für die Präsentation von 'Neuland' für zwei Tage kommen und ich habe erst um einen Tag mehr gebettelt und dann noch einen Tag auf meine Kosten drangehängt, weil das noch immer nicht gereicht hat, um alle Freunde zu sehen."
Die Stadt fasziniert ihn so sehr, dass sie den Weg in sein neues Buch gefunden hat. Seine Romanfigur Inbar besucht hier ihre Mutter und deren neuen Lebensgefährten. Und reagiert heftig auf die Stadt - sie sieht praktisch an jeder Ecke Nazis, und reizt ihre Mutter damit, die Vergangenheit nicht für einen Moment ausblenden zu können. Ist das nicht eine etwas extreme Reaktion für eine so junge Frau, die immerhin schon die dritte Generation nach dem Holocaust repräsentiert? "Sie ist zum ersten Mal in der Stadt", erklärt Nevo. "Wie sie empfindet, spiegelt wider, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal in Berlin war. Die Geschichte des Holocausts ist Teil des Erwachsenwerdens in Israel - und diese ganzen Assoziationen, die man über Deutschland oder die deutsche Sprache hat, bringt sie mit."
Und doch habe auch Inbar Spaß in der Stadt, betont Nevo. "Sie kann - ebenso wenig wie ich das konnte - nicht der Tatsache widerstehen, dass Berlin eine kosmopolitische Stadt ist, faszinierend, voller Leben." Genau über diese Ambivalenz habe er schreiben wollen. "Wenn etwas ambivalent ist, ist es interessant. Ich habe keine ambivalenten Gefühle gegenüber London oder Paris. Ich kann die Städte mögen oder nicht, aber es sind keine starken Gefühle." Zudem sei auch die Beziehung zwischen Inbar und ihrer Mutter ambivalent. "Zum einen gibt es diesen scheinbar normalen Mutter-Tochter-Trip, mit Sightseeing, Fahrradfahren und so weiter. Und auf der anderen Seite diese Wunde in ihrer Familie, über die sie nicht reden."
Für Nevo gibt es eine starke Verbindung zwischen Israel und Berlin, die niemals verschwinden wird. Die vielen Israelis, die mittlerweile hier in Berlin lebten, diese "Kolonie", seien ein Beispiel dafür. "Ja, sie kommen hierher, weil es billig ist und trendy. Und weil sie schon Freunde in der Kolonie haben, auf deren Sofa sie schlafen können. Aber es sei eben auch ein besonderer Ort für sie." Dass die jungen Auswanderer in Israel zum Teil heftig kritisiert werden, kann der Autor nicht verstehen. "Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, dass sie hier sind", sagt er. "Sie gehen nach Berlin, entwickeln neue, liberale Ideen und kehren voller Energie zurück – was soll falsch daran sein?", meint Nevo. "Und selbst wenn sie nicht zurückkommen, ist das auch eine legitime Entscheidung." Das sieht der israelische Finanzminister Yair Lapid offenbar anders. Erst kürzlich geißelte Lapid die Jugend auf seiner Facebook-Seite dafür, "bereit zu sein, das einzige Land, das die Juden haben, wegzuwerfen, weil es sich in Berlin gemütlicher leben lässt."
Weggehen, um zu träumen
Doch nicht nur Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Sehnsuchtsort junger Israelis gewandelt, auch in Lateinamerika sind unzählige unterwegs - eine der in Israel schon klassischen Reisen nach dem Militärdienst. Auch Eshkol Nevo schickt seine Hauptfigur Dori nach Lateinamerika, unter anderem, weil er auf seiner eigenen Reise nach dem Armeedienst, Mitte der 1990er Jahre, in Quito, Ecuador, seine zweite Heimat gefunden hat. "Dieses Gefühl, sich auf unerklärliche Weise zu Hause zu fühlen, das hatte ich zuvor noch nie", verrät Nevo. Seither sei er immer wieder durch Lateinamerika gereist, zuletzt für die Buchrecherche.
Doch in "Neuland" ist es nicht der Sohn, der, traumatisiert durch den Militärdienst, in Lateinamerika verschwindet, sondern der Vater. Ist das ein Sinnbild für die Generationen traumatisierter Menschen in Israel und die Unfähigkeit der Gesellschaft damit umzugehen? "Ein Anspruch des Buches war sicherlich herauszuarbeiten, dass jeder Israeli auf eine Art ein Post-Trauma hat, im Schatten eines Krieges lebt. Wir haben den Holocaust, die Kriege des Staates Israel, bei uns kann sich jeder sein Trauma aussuchen", betont Nevo und hält die Hand, an der er die Traumata aufgezählt hat, hoch. "Ich halte es aber nicht für ein Scheitern der Gesellschaft, wenn die Menschen weggehen. Für mich ist das ganz gesund, durch Reisen bekommt man eine neue Perspektive." Zudem gehe Meni Peleg nicht nach Lateinamerika, weil er Neuland aufbauen will, er gehe, weil er seine Frau so sehr vermisst, dass er in Israel nicht mehr leben kann. "Doch seine Erinnerungen verfolgen ihn bis dorthin und das bringt ihn dazu, eine neue Welt für traumatisierte Israelis aufbauen zu wollen."

In seinem utopischen Roman Altneuland (1902) entwarf Theodor Herzl sein idealistisches Bild eines künftigen Judenstaates, unter dem Motto: "Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen."
(Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)
Die Idee dazu sei ihm vor zehn Jahren bei einer Reise in Guatemala gekommen. Damals habe er in einer Gastfamilie einen geheimnisvollen, etwa 60 Jahre alten Herrn getroffen, der partout nicht verraten wollte, warum er dort war. Jahre später habe er viel über Lebensentscheidungen nachgedacht, nicht nur auf persönlicher, sondern auch auf nationaler Ebene. "Da stieß ich auf einen Artikel über die jüdischen Kolonien des Barons Hirsch in Argentinien." Jeder in Israel kenne die Geschichte über Theodor Herzl, der in Betracht zog, den jüdischen Staat in Uganda zu gründen. "Aber das blieb eine Idee. Kein Jude hat je einen Fuß dahin gesetzt." Die Baron-Hirsch-Kolonien beherbergten in ihrer Hochzeit dagegen Zehntausende Menschen. Und bis zur Staatsgründung Israels im Jahr 1948, sei die Idee eines Gebietes für Juden in Argentinien noch sehr lebendig gewesen. Bis heute lebten in der argentinischen Stadt "Moisés-Ville" etwa 5000 Menschen, ein Drittel davon sei jüdisch. Gesprochen werde Spanisch und Jiddisch und das Ganze sehe aus wie eine Kombination aus einem osteuropäischen Shtetl und einer südamerikanischen Stadt. "Wenn der Lauf der Geschichte anders gewesen wäre, wäre der jüdische Staat vielleicht in Argentinien gegründet worden. Literatur vermag sich vorzustellen, was hätte passieren können. Das ist das Großartige am Schreiben."
Angriff und Inspiration
In Israel reagierten die Leser ganz unterschiedlich auf dieses Gedankenspiel. "Es stellte sich als eine Generationenfrage heraus. Ältere Leser haben mich bei Lesungen angegriffen und behauptet, ich wäre ein Post-Zionist. Einige haben geschrien, es habe sie so viel gekostet nach Israel zu kommen und nun wolle ich sie wieder zurück Argentinien schicken."
Junge Leser seien dagegen im Allgemeinen inspiriert gewesen. "Für sie war die Einladung von einer besseren Gesellschaft zu träumen ganz natürlich." Besonders stolz ist Nevo, dass das Buch im vergangenen Jahr Teil der sozialen Proteste wurde. Auch wenn die Demonstrationen kaum Wirkung auf die aktuelle israelische Politik zu haben scheinen, bleibt Nevo optimistisch. Diese junge Generation würde die Bedingungen der Vergangenheit nicht akzeptieren. Vielleicht hätten es bislang nur zwei Anführer der Proteste ins Parlament geschafft, räumt der Schriftsteller, der ein Enkel des dritten israelischen Ministerpräsidenten Levi Eshkol ist, ein. Auf lange Sicht werde diese Generation aber eine Menge Einfluss haben. "Jetzt sind sie vielleicht alle noch in Berlin, aber sie werden zurückkommen. Und wenn sie dann immer noch Schwierigkeiten haben eine Wohnung zu finden, werden sie den Wandel fordern."
Familie oder Liebe?
Zu Nevos Überraschung gab es aber auch hitzige Diskussionen, was den romantischen Teil des Buches angeht. Für ihn sei die Geschichte zwischen Dori und Inbar sehr eindeutig gewesen, aber die Leser würden das offenbar anders sehen. Daher habe er etwas gemacht, was er zuvor nie gemacht hätte: Und zwar ein Wort in der deutschen Übersetzung geändert. "Vielleicht funktioniert es ja und die Leser in Deutschland wünschen sich dann dasselbe Ende wie ich!", lacht Nevo. [* Das gedachte Ende und das veränderte Wort finden Sie unten. Anm. der Redaktion ]
Auf 640 Seiten bringt es "Neuland" in der deutschen Übersetzung. Er sei selber überrascht, wie schwer das Buch hier aussehe, sagt Nevo und wiegt es in der Hand. Doch der Eindruck täuscht, denn "Neuland" liest sich leicht, weil es klug ist, ohne zu belehren. Wie schon bei seinen ersten beiden Romanen findet man sich in der Welt von Nevos Romanfiguren so schnell zurecht, dass man sie nicht nur seit Jahren zu kennen glaubt, sondern auch nach mehr als 600 Seiten ungern wieder verlässt. Wer will, kann in "Neuland" viel über das Leben in einem komplexen, mit Geschichte überhäuften Land wie Israel lernen. Oder er kann sich einfach selbst in dem sensiblen Beziehungsgeflecht namens Familie und Partnerschaft wiederfinden. In jedem Fall lohnt es sich, Eshkol Nevos Einladung zu folgen und über all die Wege nachzudenken, die sich im Leben und in der Gesellschaft auftun können. Ob in Quito, Berlin oder Tel Aviv.
Eshkol Nevo auf der Frankfurter Buchmesse: Mittwoch, 09. Oktober, Open Books, Alte Nikolaikirche, Römerberg 9, 18:30 Uhr, Donnerstag, 10. Oktober, Buchmesse Frankfurt litprom/Zentrum für Weltempfang Halle 5,0 E81, 10.30 Uhr.
*[Spoilerwarnung: Hier Nevos Antwort zum Ende des Buches und dem geänderten Wort: "Ungefähr die Hälfte der israelischen Leser entpuppte sich als sehr konservativ. Sie wollen, dass Dori bei seiner Frau Roni bleibt und sie ein zweites Kind kriegen. Auch wenn sie unglücklich zusammen sind. Familie geht über alles in Israel. Du kannst zwar immer neu anfangen, wenn du scheiterst, deshalb gibt es ja auch so viele Startups. Aber bei Familie zählt: Bleibt zusammen und macht möglichst viele Kinder. Ich habe selber drei! Aber ich wollte natürlich, dass Dori und Inbar zusammen glücklich werden. Deshalb habe ich sogar ein Wort in der deutschen Übersetzung geändert. Das habe ich noch nie gemacht. In der hebräischen Ausgabe sagt Roni 'ohne Emotionen' : 'Wir kriegen natürlich ein zweites Kind.' In der deutschen Ausgabe sagt sie es 'ohne Liebe'."]
Quelle: ntv.de