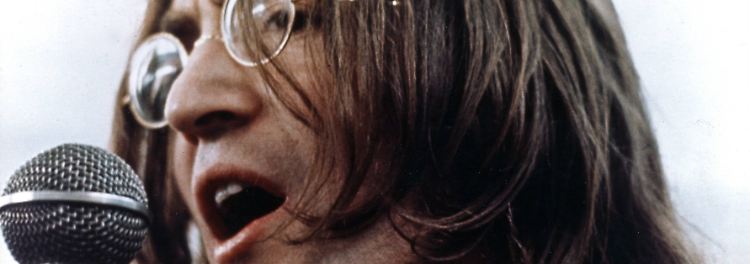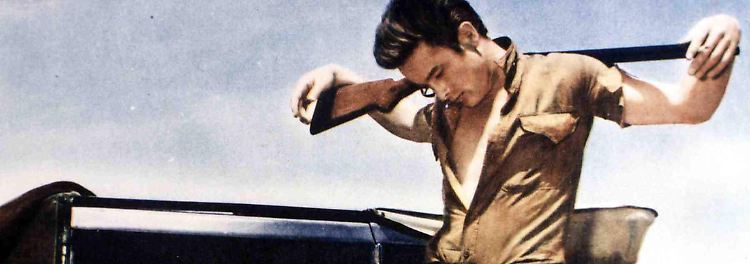Amore im mittleren Alter Der Majoran macht's
20.09.2014, 12:29 Uhr
Schmetterlingsliebe auf wildem Majoran.
(Foto: imago stock&people)
"Männer sind Mai, wenn sie freien, und Dezember in der Ehe." Upps! Spricht da eigene Erfahrung aus den Worten des Dichters? Für seine Frau Anne hatte William Shakespeare jedenfalls nur das "zweitbeste Bett" übrig.

Shakespeare nicht mehr ganz taufrisch: Skulptur des Dichters im Park an der Ilm in Weimar (Thüringen).
(Foto: picture alliance / dpa)
William Shakespeare hat die Liebe in all ihren Facetten beschrieben - hat er sie aber auch selbst so dermaßen reich erfahren? Fast 400 Jahre nach seinem Tod wissen wir nur, dass Anne H athaway sieben Jahre älter war und im dritten Monat schwanger, als sie und William (gezwungenermaßen?) heirateten, und dass er testamentarisch das beste Bett seiner Tochter Susanna vermachte, seiner Gattin nur das zweitbeste. Wie und wen und warum der große Engländer wirklich liebte, wird sich wohl auf ewig im Dunkel der Geschichte verbergen.
Seine Dramen und Sonette aber begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Nur aus der Bibel wird noch häufiger zitiert als aus Shakespeares Werken. Bis heute sind über 400 Filme nach seinen Theaterstücken entstanden; damit ist Shakespeare der am meisten verfilmte Dramatiker weltweit. Wer kennt nicht "Romeo und Julia"? Die erste Bekanntschaft mit dem wohl berühmtesten Liebespaar der Welt nach Adam und Eva wird üblicherweise in der Schule gemacht, wobei selbst das normalerweise zum Literaturunterricht gehörende Augenverdrehen der Pupertätsgeplagten ausbleibt. Zumeist jedenfalls, denn heimlich ist in jenem jugendlichen Alter doch jeder ein bisschen Julia oder ein bisschen Romeo. Und keine schulische Theater-AG kommt ohne die beiden Veroneser aus, deren zarte Bande oft auch die zwischen den jugendlichen Hauptdarstellern offenbart.
Shakespeare bedichtete aber nicht nur die junge Liebe; der Dramatiker wurde schließlich auch älter, kannte sich offensichtlich auch mit den Problemen (über)reifer Liebhaber aus und wusste zuweilen Rat. In einer Zeit, in der Küchenkräuter oftmals die einzigen Heilmittel waren, machte manch grünes Blättlein nicht nur den Schweinebraten bekömmlicher, sondern linderte Gebrechen von Blähungen bis Schnupfen. Viele der wohltuenden Wirkungen sind Realität und zwar bis heute - Pharmazie und Kosmetikindustrie machen regen Gebrauch davon. Natur reicht von Aloe bis Zimt.
Bei manch anderen Wirkungen war aber eher der Wunsch Vater des Gedanken; der Glaube an Aphrodisiaka ist vermutlich so alt wie die Menschheit und hält selbst im aufgeklärten Viagra-Zeitalter an. Zumindest bei Austernschlürfern, denn Austern sollen ja das Aphrodisiakum schlechthin sein, wobei es wohl eher der dazu geschlürfte Champagner ist, der auch die zickigste Maid milde stimmt und den schüchternsten Liebhaber mutig macht.
Hilfreich oder nicht hilfreich - das ist hier die Frage
Man(n) muss aber nicht immer so tief in die Tasche greifen, es geht auch ohne Austern. Shakespeares Rat ist billig und mit jedem Einkauf im Supermarkt in die Tat umzusetzen: "Lavendel, Minze, Salbei, Majoran, die Ringelblum', die mit der Sonn' entschläft und weinend mit ihr aufsteht: Das sind Blumen aus Sommers Mitte, die man geben muss den Männern mittlern Alters." Na also, ein bisschen Grünzeug in die Suppe, in den Drink, unters Kopfkissen - schon ist alles wieder im Lot. Für William Shakespeare war Majoran jedenfalls "the herb of Grace" - das Kraut des Liebreizes.

Stillleben mit Majoran und Oregano - beide verwandten Lippenblütler sind gute Küchenkräuter.
(Foto: imago stock&people)
Schon in der Antike glaubte man an die lendenstärkende Wirkung zum Beispiel von Majoran, denn schließlich zählte Majoran im alten Griechenland zu Aphrodites Lieblingspflanzen. Dort wurde das Pflänzchen nach dem Sohn des Priesterkönigs Amarakos genannt. Der schöne Jüngling stellte für die Liebesgöttin kostbare Salböle her. Als ihm eines Tages eine Schale der wertvollen Substanzen zu Boden fiel und zerbrach, fiel Amarakos vor Schreck tot um. Daraufhin verwandelte Aphrodite ihren geliebten Schützling in eine Majoranpflanze, die genauso verführerisch duftete wie seine Salben. Sowohl die Blätter als auch die Blüten der Pflanze verströmen kurz vor dem Erblühen einen betörenden Duft.
Griechen und Römer vermuteten in der geheiligten Pflanze der Aphrodite liebessteigernde Kräfte; die römische Bezeichnung der Pflanze, amaracum, führt auch die Liebe im Namen und erinnert an Gott Amor. Deshalb braute man in der Antike allerlei Salben und Weine aus Majoran, um die Potenz zu steigern. Ob es sich dabei wirklich um echten Majoran (Origanum majorana) oder den weitaus würzigeren Oregano (Origanum vulgare) handelte, weiß niemand. Lange Zeit jedenfalls wurden beide Kräuter verwechselt. Macht aber nichts, sie sind eng verwandt, schmecken und wirken ähnlich.
Majoran ist eine der ältesten Kulturpflanzen; schon 1000 v. Chr. wurde er in Ägypten angebaut und als Gewürz, Heilmittel und Parfümrohstoff genutzt. Seine wohltuende Wirkung ist also schon sehr lange bekannt. Johann Joachim Becher (1635 - 1682), Medizinprofessor aus Speyer, nicht ganz unumstritten wegen seiner visionären Ideen, hat sich seiner Zeit gemäß viel mit Alchemie beschäftigt - oder wie er selbst schreibt, habe er viel "probirt, laborirt und speculirt". In seinen "Parnassi illustrati", erschienen 1663, beschreibt er unter anderem die Wirkungsweise von Kräutern auf den menschlichen Organismus: "Der Majoran, der gibt dem Quendel nicht viel nach. Er stillt der Nerven und der Mutter Ungemach. Er stärckt das Hirn und Haupt, macht Niessen, treibt den Wind..."
Wie es euch gefällt
Auch heute noch deuten volkstümliche Bezeichnungen auf die wohltuende Wirkung des Majoran hin: Badkraut oder auch "Pflänzchen Wohlgemut". Das in der Pflanze enthaltene ätherische Öl soll nämlich bei nervöser Unruhe, gegen Kopfschmerzen, Migräne, Schlaflosigkeit und Menstruationsstörungen helfen. Majoran wird außerdem eingesetzt zur Hautheilung, gegen Juckreiz, zur Muskelentspannung und als Duftstoff in Seifen und Mundwasser.

Unmöglich ohne Majoran:Traditionelle britische Würstchen mit Kartoffelpüree und Zwiebelsauce.
(Foto: imago stock&people)
In erster Linie aber stärkt Majoran die Verdauung, weniger das Hirn und noch weniger die Manneskraft. Aber als Küchenkraut ist Majoran auch heute noch schlichtweg unentbehrlich. Sein aromatischer Geschmack mit einer leicht bitteren Kampfernote passt am besten zu deftiger Küche; das ätherische Öl macht schwere Speisen verdaulicher. Vor allem in der Kombination mit Zwiebeln und Knoblauch verfeinert Majoran Gerichte aus Schwein und Hammel, passt sehr gut zu Hackfleisch und Eintöpfen. Der umgangssprachliche Name "Wurstkraut" zeigt eindeutig, dass das Kraut ein Standardgewürz bei der Wurstherstellung ist.
Die Briten lieben ihren großen Dichter und die kleinen Würstchen. Und falls das mit der Liebes-Hilfe vom Majoran partout nicht klappen will, greifen Sie dennoch zu Shakespeare und Sausages. Der weise Dichter macht uns klug und die Wurst satt: "Das ist das Ungeheuerliche in der Liebe, dass der Wille unendlich ist und die Ausführung beschränkt, dass das Verlangen grenzenlos ist und die Tat ein Sklave der Beschränkung." (Aus: "Troilus und Cressida").
Englische Würstchen (Sausages):
500 g mageres durchgedrehtes Schweinefleisch
250 g fettes durchgedrehtes Schweinefleisch (Hackepeter)
250 g frische Weißbrotkrumen
1 TL frische Majoranblättchen, fein gehackt
½ TL frische Salbeiblätter, fein gehackt
½ TL frische Thymianblättchen, feingehackt
¼ TL geriebene Muskatnuss
Salz, reichlich schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Öl zum Braten
Zubereitung:
Alle Zutaten gut vermischen und den Fleischteig schön glatt kneten. Daumengroße und ebenso dicke Würstchen formen.
In der Pfanne in wenig Öl goldgelb braten. Mit scharfem Senf und gegrillten Tomaten zu frischem Weißbrot reichen.
Viel Spaß beim Shakespeare-Entstauben wünscht Ihnen Heidi Driesner.
Quelle: ntv.de