Bilderserien





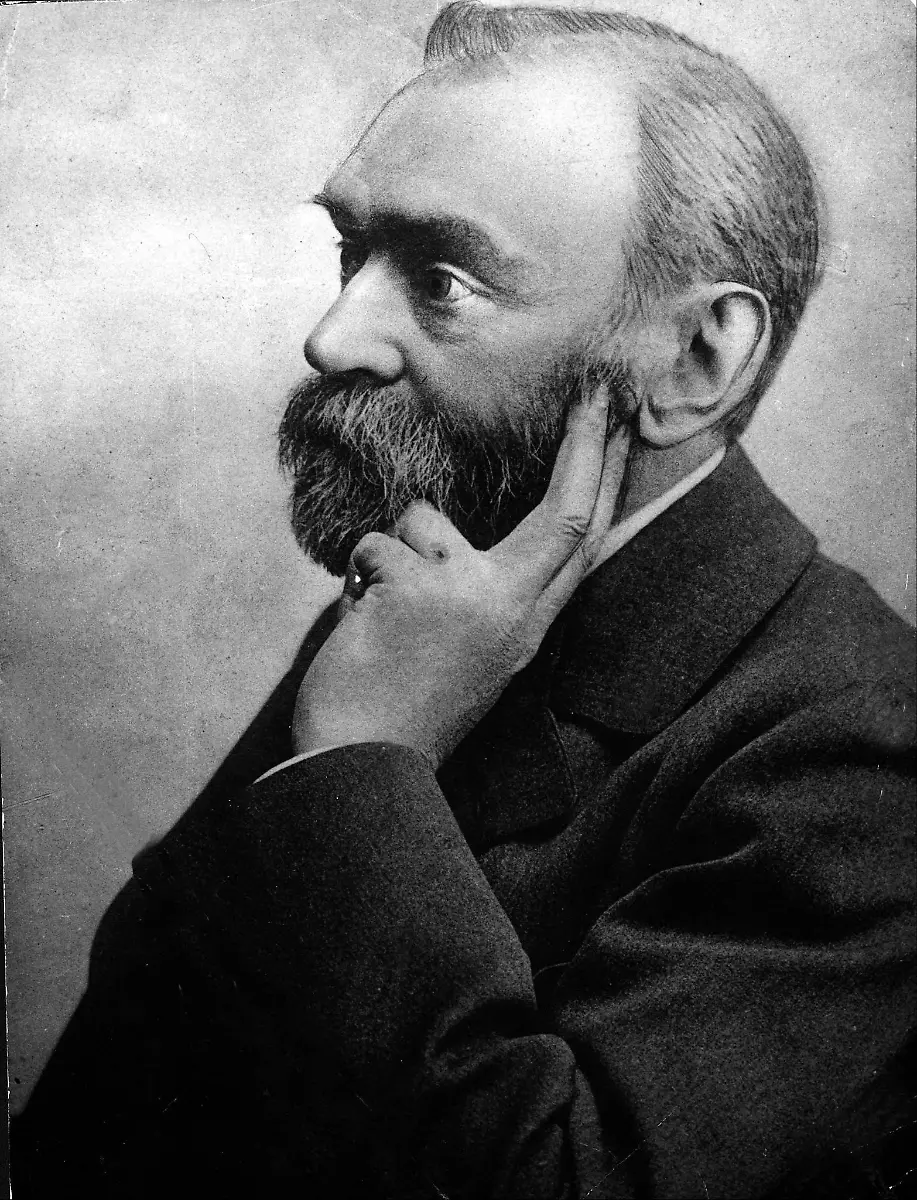

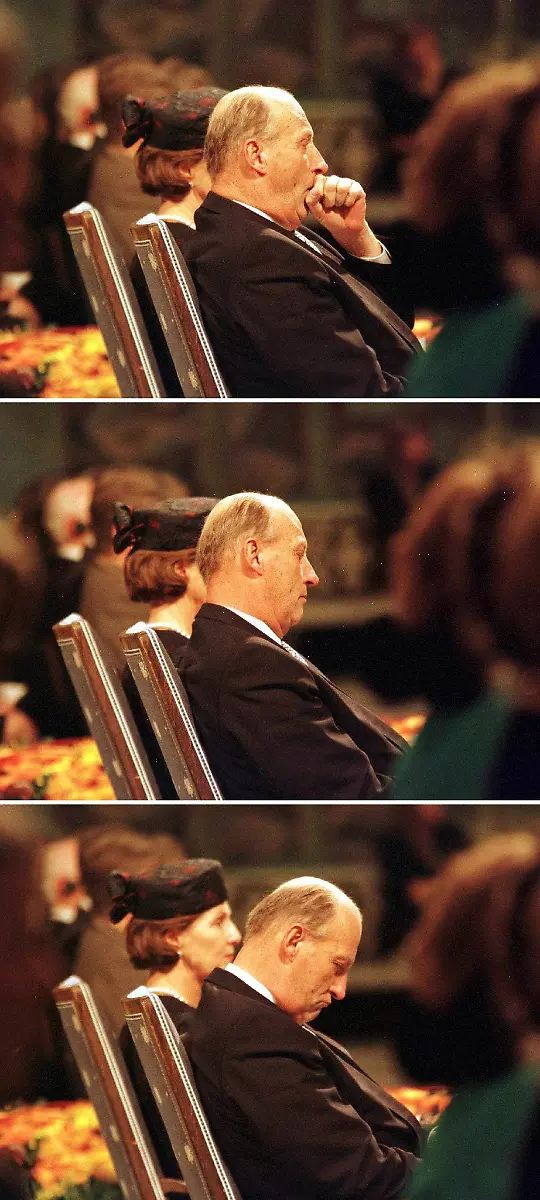





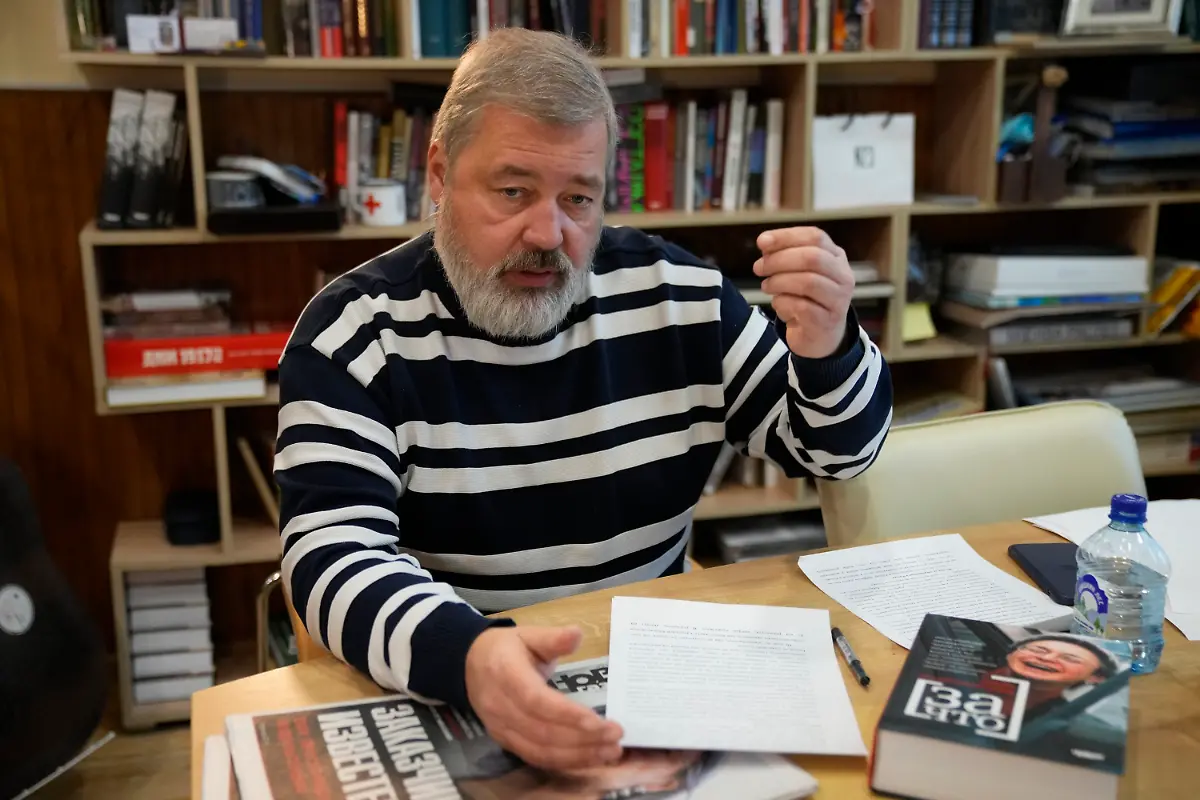





















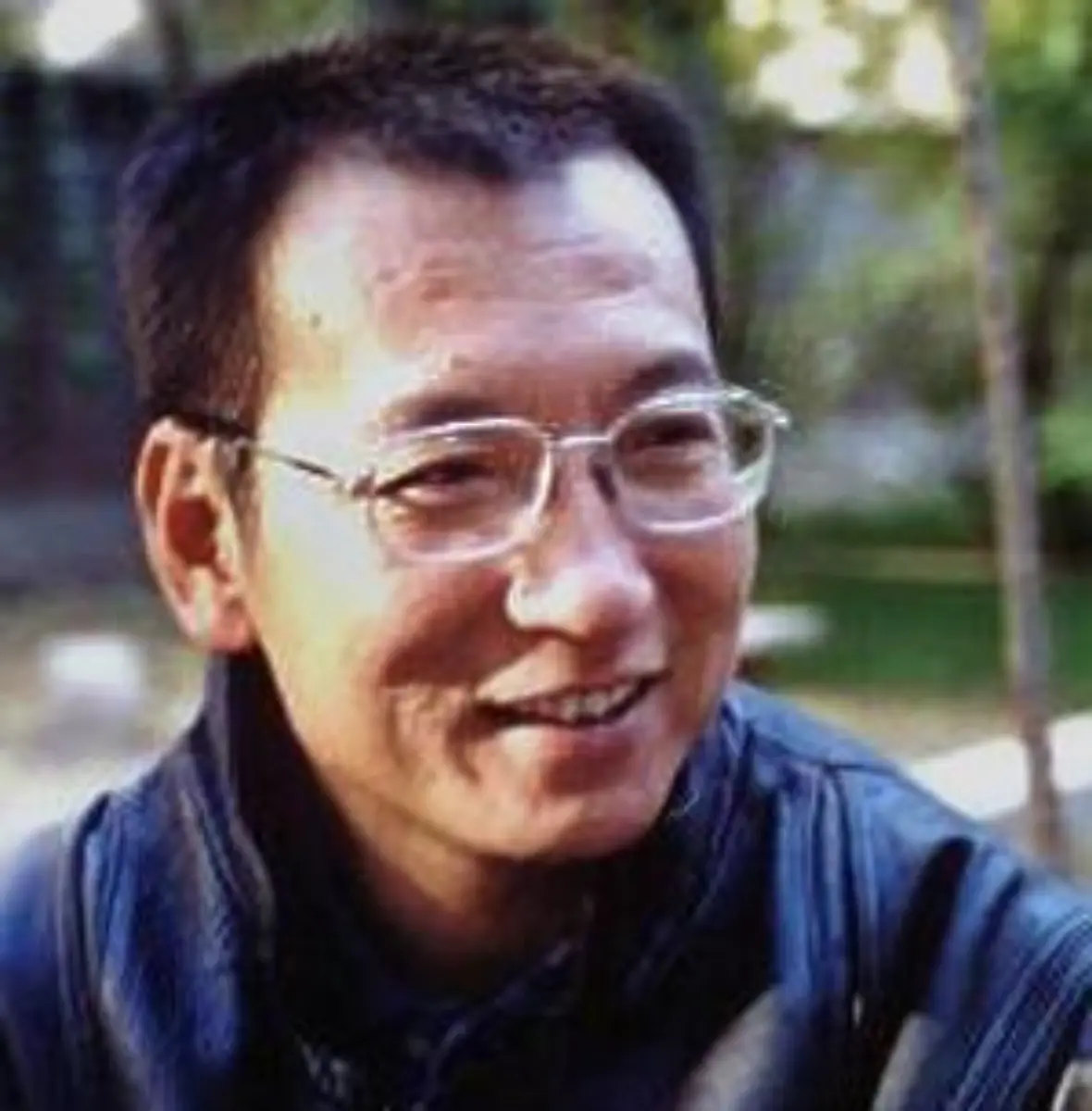







Ehrung für Inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi kämpft für Irans Frauen
06.10.2023, 11:45 Uhr
Narges Mohammadi widmet ihr Leben dem Kampf für die Rechte der Frauen im Iran, einem Kampf, der nach dem Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini der ganzen Welt präsent wurde. Dafür erhält Mohammadi den Friedensnobelpreis. Sie reiht sich damit in eine Reihe denkwürdiger, aber auch umstrittener Preisträger ein.