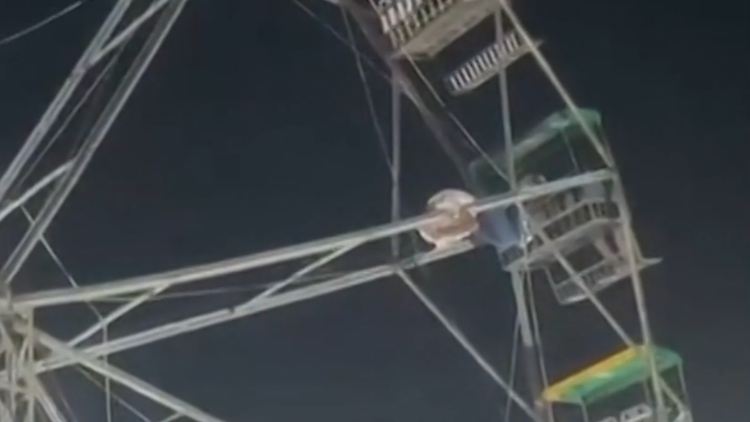Gedopt ins Büro Millionen Deutsche putschen sich auf
17.03.2015, 12:08 Uhr
Schnell noch eine Pille gegen die Angst vor der Präsentation? Die Anzahl der Hirndoper ist gestiegen.
(Foto: imago stock&people)
Kaum einer redet darüber, immer mehr Menschen tun es: Um Leistung und Laune zu steigern, helfen rund drei Millionen Berufstätige mit "Smart Pills" nach. Männer dopen aus anderen Gründen als Frauen.
Stress, wachsender Leistungsdruck und permanente Verfügbarkeit: Viele Menschen stoßen im Arbeitsalltag an ihre Leistungsgrenzen - und ertragen das tägliche Hamsterrad offenbar nur noch unter Drogen. Wie verbreitet ist die Leistungssteigerung mit Medikamenten? Warum greifen Arbeitnehmer zur Pille? Und wie kommen die Doper an die Präparate? Das wollte die DAK Gesundheitskasse wissen und wertete die Arzneimitteldaten von 2,6 Millionen erwerbstätigen Mitgliedern aus. Die Ergebnisse sind alarmierend.
- Methylphenidat: Das Präparat wird beim Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) sowie der Schlafkrankheit eingesetzt. Es steigert die Konzentration und hemmt das Bedürfnis nach Schlaf und Nahrung.
- Modafinil: Das Medikament wird ebenfalls bei Schlafkrankheit verabreicht. Es ist ein Wachmacher, der zum Beispiel bei Sekundenschlaf helfen soll und bei einem Jetlag auf Reisen.
- Betablocker: Diese Präparate werden bei Bluthochdruck verwendet. Sie beruhigen, indem sie die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin hemmen. Von gesunden Menschen wird das Präparat gerne eingenommen, um Prüfungsangst zu lindern.
- Antidepressiva: Solche Präparate sind Stimmungsaufheller. Sie wirken gegen Depressionen, aber auch gegen Panikattacken.
- Antidementiva: Diese Mittel werden bei Demenz- beziehungsweise Alzheimer-Erkrankung eingesetzt. Die Mittel steigern auch die Gedächtnisleistung.
- Amphetamine: Zu den Stimulanzien gehören auch illegale Drogen wie Crystal Meth oder Ecstasy.
Nebenwirkungen: Alle Präparate können massive Nebenwirkungen haben. Dazu gehören Herz-Rhythmus-Störungen, Unruhe und Schlafstörungen. Einige können auch den Wunsch nach Selbsttötung hervorrufen.
Knapp drei Millionen Menschen in Deutschland schlucken dem DAK- Report zufolge verschreibungspflichtige Pillen, um am Arbeitsplatz leistungsfähiger zu sein. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Binnen sechs Jahren hat sich die Anzahl der Beschäftigten, die "Hirndoping" betreiben, um eine Million Menschen erhöht.
Warum greifen so viele Berufstätige zur Pille? Zu hoher Leistungsdruck sowie Stress und Überlastung machen viele Arbeitnehmer-Seelen zu schaffen. Es ist die Angst, zu versagen, sich vor den Kollegen zu blamieren und Fehler zu machen. Vier von zehn Dopern gaben an, bei konkreten Anlässen wie Präsentationen oder wichtigen Verhandlungen Medikamente zu schlucken.
Männer putschen sich auf, Frauen beruhigen sich
Männer versuchen laut Studie damit vor allem, noch leistungsfähiger beim Erreichen ihrer beruflichen Ziele zu werden. Zudem wollen sie auch nach der Arbeit noch Energie für Freizeit und Privates haben. Frauen nehmen hingegen solche Medikamente am ehesten, damit ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht und sie emotional stabil genug sind.
Am häufigsten greifen die Beschäftigten zu Medikamenten gegen Angst, Nervosität und Unruhe (60,6 Prozent) sowie zu Mitteln gegen Depressionen (34 Prozent). Etwa jeder achte Doper schluckt Tabletten gegen starke Tagesmüdigkeit.
Das Vorurteil vom pillenschluckenden Top-Manager widerlegt die Studie. Hirndoping zieht sich demnach durch alle Berufsfelder, Hierarchieebenen und Qualifikationen. Eine wichtige Rolle spielen dagegen das Tätigkeitsniveau der Arbeit und die Beschäftigungssicherheit. Die Studie bilanziert: "Je unsicherer der Arbeitsplatz und je einfacher die Arbeit selbst, umso höher ist das Risiko für Hirndoping."
Drogen ganz einfach auf Rezept?
Und wie kommen die Doper an die Pillen? Laut DAK-Studie bekommt jeder Zweite für die entsprechenden Medikamente ein Rezept vom Arzt. Ein erstaunlicher Wert, der einen stutzigen Blick auf die Ärzteschaft erlaubt. So hätten Ärzte teilweise Antidepressiva ohne "medizinisch nachvollziehbare Begründung" verordnet. Bei rund zehn Prozent der Versicherten, denen beispielsweise Ritalin verordnet wurde, fehlte eine entsprechende Diagnose.
Jeder Siebte erhält Tabletten von Freunden, Bekannten oder Familienangehörigen, und jeder Zwölfte bestellt sie ohne Rezept im Internet.
Warum die große Mehrheit der deutschen Berufstätigen kein Hirndoping betreibt, hat die Studie auch untersucht. Demnach kommt für 70,1 Prozent der Gebrauch von Neuro-Enhancern grundsätzlich nicht infrage, wenn ein Arzt nicht ausdrücklich dazu rät. Der zweithäufigste Grund seien Risiken und Nebenwirkungen der Medikamente, die seit Bekanntwerden des Themas geläufiger wurden.
Nur kurzfristige Effekte, dafür enorme Risiken
"Auch wenn Doping im Job in Deutschland noch kein Massenphänomen ist, sind diese Ergebnisse ein Alarmsignal", warnte DAK-Vorstandschef Herbert Rebscher. Suchtgefahren und Nebenwirkungen des Hirndopings seien nicht zu unterschätzen.
Nach Angaben des Doping-Experten Klaus Lieb zeigen die Medikamente oft nur kurzfristige und minimale Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite gebe es "hohe gesundheitliche Risiken, wie körperliche Nebenwirkungen bis hin zur Persönlichkeitsveränderung und Abhängigkeit", erklärte der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz. Es könne zu Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität und Schlafstörungen kommen, mögliche Langzeitfolgen seien noch völlig unklar.
Quelle: ntv.de, dsi/AFP