Historiker Jan C. Behrends"Russland ist ein in Auflösung befindliches Imperium"
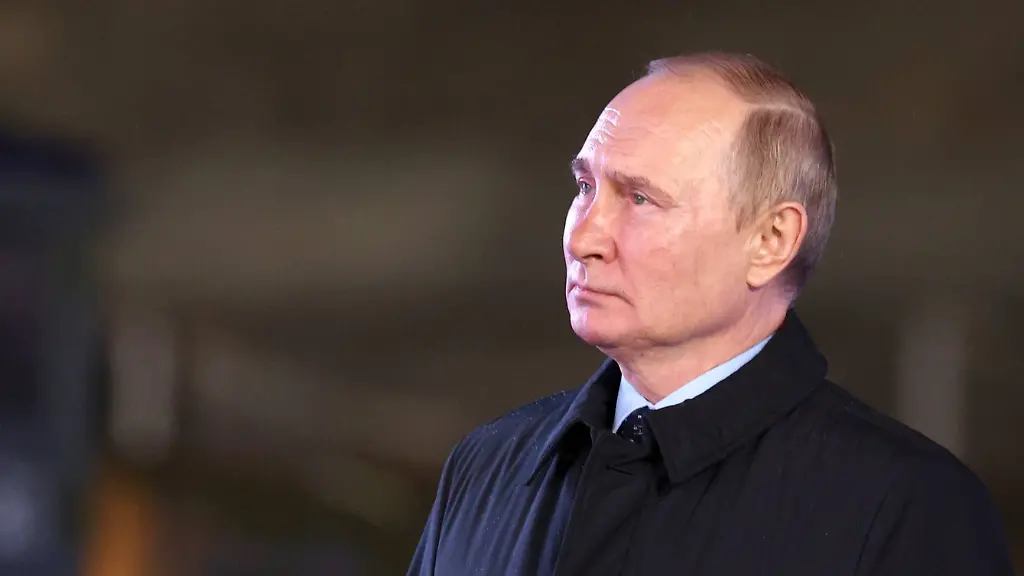
Vom Wagenknecht-Schwarzer-Manifest hält der Osteuropa-Historiker Jan Behrends nichts. "Dass man gegen Tyrannei zur Waffe greifen kann, ist in anderen Ländern eine viel stärkere Selbstverständlichkeit."
Vom Wagenknecht-Schwarzer-Manifest hält der Osteuropa-Historiker Jan Behrends nichts. "Dass man gegen Tyrannei, gegen äußere Aggression und für nationale Selbstbestimmung zur Waffe greifen kann, ist in anderen Ländern eine viel stärkere Selbstverständlichkeit. In Deutschland ist es in bestimmten Kreisen dagegen völlig legitim, genau dies anzuzweifeln."
Putin geht es um die Rückkehr zur Ordnung von Jalta, sagt der Historiker. "Diese Ordnung legte fest, dass die sowjetische Hegemonie bis zur Elbe reichte", so Behrends. "Putin schreibt und sagt ja ganz offen, dass er Russlands Einflusssphäre nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Osteuropa wiederherstellen will."
ntv.de: Der Historiker Timothy Snyder hat den russischen Krieg gegen die Ukraine einen Kolonialkrieg genannt. Trifft es das?
Jan C. Behrends: Als Historiker würde ich sagen, dass dieser Krieg ein Kolonialkrieg ist, weil ich ihn als Teil des Auflösungsprozesses des russischen Imperiums sehe. Diese Entwicklung begann 1917 und dauert an. Russland und die Ukraine waren Zentrum und Peripherie, das ist durchaus eine koloniale Geschichte. Von der Art des Krieges ist es allerdings kein klassischer Kolonialkrieg wie ihn europäische Mächte im 19. Jahrhundert führten, sondern ein Staatenkrieg zwischen zwei souveränen Nationen. Russlands Ziel ist die erneute Unterwerfung, für die Ukraine geht es darum, sich aus der imperialen Umklammerung durch Russland zu lösen. Putin schreibt und sagt ja ganz offen, dass er Russlands Einflusssphäre nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Osteuropa wiederherstellen will. Ihm geht es um die Rückkehr zur Ordnung von Jalta.
Ist Russland denn eine Kolonialmacht?
Selbstverständlich. Das Russische Reich war ein Imperium, schon seit dem 16. Jahrhundert, der Zeit Iwans des Schrecklichen. Es war kein Übersee-Imperium wie Frankreich oder Großbritannien, sondern eine Landmacht, ein Vielvölkerreich, und als solches hat es immer koloniale Beziehungen zu anderen Völkern unterhalten - von den Tataren über Polen oder Finnland bis hin zu den Völkern Sibiriens, Zentralasiens oder des Kaukasus. Überall dort und auch in der Ukraine ist Russland als imperiale Macht aufgetreten. Doch seit 1917 ist es ein in Auflösung befindliches Imperium.
Seit 1917? Ist das nicht ein sehr langer Zeitraum für einen Verfall?
Imperien lösen sich langsam auf, das sehen wir an den historischen Großreichen von Rom bis zum britischen Empire. Das passiert nicht mit einem Knall, sondern dauert Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Im Fall des russischen Imperiums haben wir es mit einem Prozess zu tun, den wir seit dem Ersten Weltkrieg beobachten können: eine langsame Ablösung der Peripherien erst von Petersburg, dann von Moskau, und darauf reagierend die Versuche, das Imperium wiederherzustellen. Einer dieser Versuche war die Sowjetunion, ein Russisches Reich unter kommunistischen Vorzeichen, das dann aber 1991 zerfallen ist. Unter Putin findet jetzt ein weiterer Versuch des Zentrums statt, die alten Beziehungen wiederherzustellen. Aber wir sehen in der Ukraine zugleich die Stärke der nationalstaatlichen Idee und die Bereitschaft der Ukrainer und Ukrainerinnen, für ihre Souveränität und gegen die Unterwerfungsversuche Moskaus zu kämpfen.
Sie haben den russischen Überfall auf die Ukraine das Aufbäumen der letzten sowjetischen Generation genannt. Was meinen Sie damit?
Putins Generation ist die letzte, die komplett im sowjetischen Imperium sozialisiert wurde. Für diese Generation ist die Ordnung von Jalta die natürliche Ordnung Europas.
Auf der Konferenz von Jalta auf der Krim haben Roosevelt, Churchill und Stalin im Februar 1945 die Aufteilung Europas beschlossen.
Diese Ordnung legte fest, dass die sowjetische Hegemonie bis zur Elbe reichte. Sie endete 1989 in Europa beziehungsweise 1991 mit der Auflösung der UdSSR. In Putins Sicht hat der Westen einen kurzen Moment der russischen Schwäche genutzt, um die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sowjetische Stellung zu zerstören. Wenn man sich seine Forderungen aus den Vertragsentwürfen anschaut, die Russland im Dezember 2021 den USA übergeben hat, dann wird deutlich, worum es ihm geht: Russland fordert darin einen Rückzug der NATO auf den Stand von 1997, also auf die Zeit vor der ersten Osterweiterung. Faktisch war das ein Ultimatum an den Westen. Wenn man die Vertragsentwürfe genau liest, stellt man fest, dass sie darauf hinauslaufen, Jalta wiederherzustellen, eine Ordnung, die eben für die letzte sowjetische Generation geopolitisch ein starkes Identifikationsobjekt ist. In gewisser Weise ist das auch eine gute Nachricht.
Inwiefern?
Nachfolgende russische Generationen, die irgendwann an die Macht kommen werden, teilen diese Obsession mit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg und mit der Herrschaft über Osteuropa nicht.
Welches Geschichtsbild propagiert die russische Regierung?
Im offiziellen russischen Geschichtsbild geht es stets um die Größe und die Macht Russlands. Das Imperium kann dabei unterschiedliche Formen annahmen: das Zarenreich, die Sowjetunion unter Stalin oder auch Russland unter Putin. Die Kontinuität, die betont wird, ist Russland als Großmacht auf der internationalen Bühne. Der russischen Bevölkerung wird erzählt, dass die Großmachtstellung wichtiger sei als allgemeiner Wohlstand oder ein funktionierendes Sozialsystem. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen diesem imperialen Staat und der Ukraine. Dort ist es das Ziel der Politik, die Verhältnisse im eigenen Land zu verbessern. Kiew hat keine Großmachtambitionen. Den russischen Eliten und Putin kommt es darauf an, dass ihr Land international gefürchtet wird. Dafür sind sie sogar bereit, den Wohlstand und die Zukunft Russlands zu riskieren.
Welche Rolle spielt Stalin in der offiziellen Propaganda?
Putin hat den Siegeskult noch weiter überhöht. Es gab diesen Kult schon vorher, eingeführt wurde er unter Leonid Breschnew, …
… von 1964 bis 1982 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
Wie schon unter Breschnew kann man einen solchen Siegeskult nur betreiben, wenn man Stalin ein Stück weit rehabilitiert, denn er war 1945 der Oberbefehlshaber. Darüber hinaus glaube ich, dass Wladimir Putin Stalin bewundert. Er sieht in ihm denjenigen, der die russische Einflusssphäre in Osteuropa geschaffen hat. Am Beispiel Stalins kann man auch zeigen, dass russische Geschichtspolitik nicht nur ein Kult des Erinnerns ist, sondern auch des Vergessens: Putins Propaganda feiert den Stalin von 1945, den Triumphator von Berlin, den großen Feldherrn. Über die Zeit des Großen Terrors, über den Gulag und den Hitler-Stalin-Pakt wird geschwiegen - der Stalin der 30er Jahre verschwindet hinter dem Sieger von 1945.
Putins Regime ist häufig als Kleptokratie beschrieben worden, als unideologischer Mafia-Staat. War das falsch?
Der unideologische Aspekt war sicherlich falsch. Mafia-Staat, das ist eine Analogie, die beschreibt, dass die informellen Beziehungen zum Paten und Drohungen mit Gewalt wichtiger sind als institutionelle Beziehungen. So weit, so zutreffend. Aber dieser Krieg zeigt, dass die imperiale Ideologie zumindest für den Kern der russischen Elite wichtiger ist als die Selbstbereicherung, die sie natürlich auch ausgiebig betrieben haben. Sie nehmen die Sanktionen in Kauf, sie nehmen in Kauf, dass sie nicht mehr nach Cannes oder Miami fahren können. Ihre Priorität ist der Krieg gegen die Ukraine. Sie sind bereit, für die imperiale Expansion einen hohen Preis zu bezahlen.
Was würde passieren, wenn Russland den Krieg gewinnen sollte - entweder weil der Westen seine Unterstützung für die Ukraine einstellt oder weil diese Unterstützung nicht groß genug ist?
Zunächst einmal wäre es für die Ukraine eine Katastrophe. Es würde die erneute Unterwerfung bedeuten. Es würde bedeuten, dass imperiale Projekte in Europa wieder eine Zukunft haben, dass die Ordnung der souveränen Nationalstaaten von 1989/91 wankt. Für das Baltikum und die Staaten Osteuropas würde es eine konkrete Bedrohung bedeuten. Aber es wäre auch eine Niederlage für den Westen. Das Selbstbewusstsein, das der Westen nach der Katastrophe von Afghanistan durch die sehr geschlossene Reaktion auf die russische Aggression gewonnen hat, würde wieder infrage stehen. Das könnte eine neue Krise des Westens auslösen.
Was halten Sie von dem "Manifest für Frieden" von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer?
Gar nichts.
Gibt es solche Aufrufe auch in osteuropäischen Staaten?
Davon ist mir nichts bekannt.
Warum ist die öffentliche Debatte in Deutschland so anders als etwa in Polen?
Ich denke, dass dies mit den unterschiedlichen historischen Erfahrungen zu tun hat. Nach zwei verlorenen Weltkriegen können viele in Deutschland sich gar nicht mehr vorstellen, dass man Kriege auch gewinnen kann - nach 1871 konnte man sich das in Deutschland noch ganz gut vorstellen, da dachte man, dass Deutschland jeden Krieg gewinnt. Das ist gewissermaßen von einem Extrem ins andere gekippt. Zu den negativen Erfahrungen mit Krieg kommen die weniger negativen Erfahrungen mit der Besatzung. Das wird in Deutschland häufig nicht gesehen: dass Besatzung für die Ukraine etwas ganz anderes ist, als die Besatzung durch die Amerikaner oder Briten nach 1945 für Westdeutsche war. Für die Ukraine bedeutet Besatzung nicht das Ende des Kriegs, sondern den Beginn des Terrors gegen die Zivilbevölkerung.
Außerdem fürchte ich, dass wir keinen so emphatischen Freiheitsbegriff haben wie Polen, Frankreich, die Ukraine oder die USA. Deutschland ist von außen vom Nationalsozialismus befreit worden. Dass man gegen Tyrannei, gegen äußere Aggression und für nationale Selbstbestimmung zur Waffe greifen kann, ist in anderen Ländern eine viel stärkere Selbstverständlichkeit. In Deutschland ist es in bestimmten Kreisen dagegen völlig legitim, genau dies anzuzweifeln.
Mit Jan C. Behrends sprach Hubertus Volmer