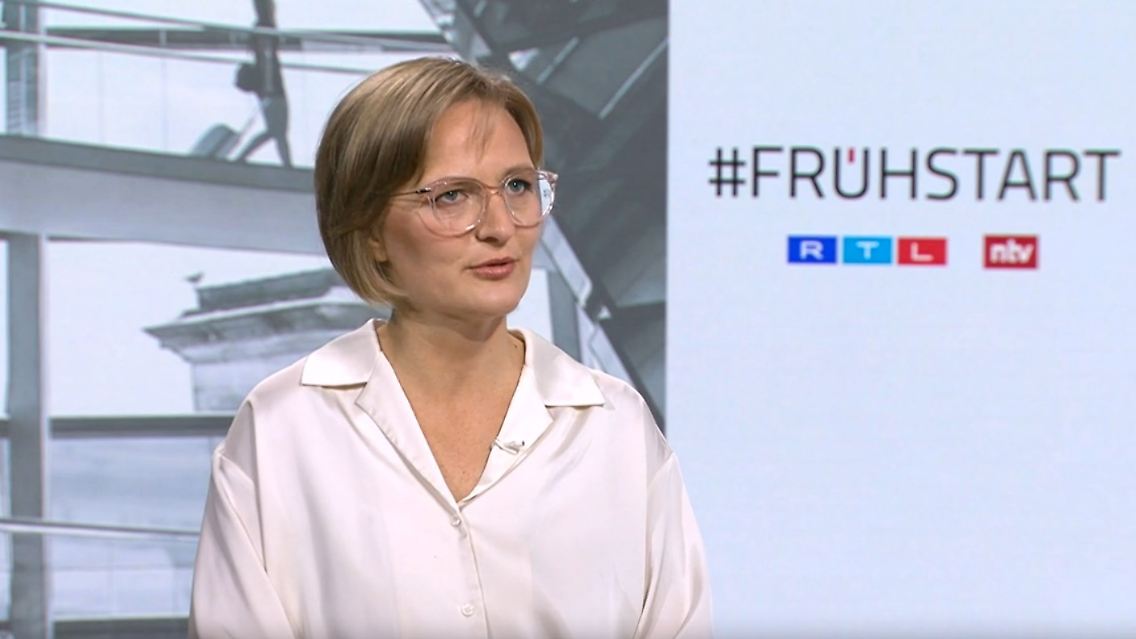Hatte Habeck doch recht? So viel Ampel steckt noch in Schwarz-Rot
 06.11.2025, 15:00 Uhr
Artikel anhören
06.11.2025, 15:00 Uhr
Artikel anhören

Habeck und Merz beim RTL-Quadrell - damals ahnte niemand, dass Merz dem Sondervermögen zustimmen würde.
(Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool)
Heute vor einem Jahr zerbrach die Ampel-Koalition. Schwarz-Rot wollte alles anders machen, aber tut die junge Koalition das auch? In Teilen natürlich schon. Aber es gibt auch überraschende Kontinuitäten.
Der 6. November 2024 war ein Tag, der für so manchen in Deutschland mit einem Schock begann: Donald Trump gewann die US-Präsidentschaftswahl. In Deutschland endete der Tag mit weiteren Breaking News: Die Ampel-Koalition zerbrach, nachdem Kanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen hatte - SPD, Grüne und FDP hatten sich nicht auf einen neuen Haushalt einigen können.
Neu an der Ampel war vieles - vor allem der immense Vertrauensverlust, den die drei Parteien während ihrer dreieinhalbjährigen Regierungszeit erlitten. CSU-Chef Markus Söder ätzte, die Ampel sei die schlechteste Regierung aller Zeiten gewesen, Robert Habeck der schlechteste Wirtschaftsminister. CDU-Chef Friedrich Merz verhöhnte Scholz als "Klempner der Macht". "Sie können es nicht!", schleuderte er dem SPD-Politiker einmal im Bundestag entgegen. Damit erweckten die Unionsparteien ganz bewusst den Eindruck: Wir können es besser. Und: Mit uns wird alles anders.
Aber wie viel hat sich wirklich geändert? Die Grünen sind in der Opposition, Habeck ist weg - Lindner auch, seine FDP kämpft außerhalb des Bundestages gegen die Bedeutungslosigkeit. Für Steuersenkungen und gegen Schulden kämpft seither eigentlich niemand mehr so richtig. Aber es gibt auch mehr Kontinuität, als sich die meisten noch kurz vor und nach der Wahl vorstellen konnten. Ein Überblick:
Schuldenbremsen-Reform und Sondervermögen: Streng genommen kann man hier nicht von Kontinuität sprechen. Denn die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben auszusetzen, das hätte in der Ampel keine Chance gehabt. Die FDP hätte dem nicht zugestimmt. Aber auch Merz hatte den Eindruck erweckt, erstmal müsste kräftig gespart werden, bevor man vielleicht später, irgendwann einmal, an die Schuldenbremse geht. Aber das war vor der Wahl. Nach der Grundgesetzänderung sagte er, die Furcht, die USA könnten die Nato verlassen, habe ihn umdenken lassen.
Trotzdem ist das ein Schritt, wie ihn sich zwei der drei Ampelparteien, Grüne und SPD, erträumt hatten. Scholz und Habeck machten sogar Wahlkampf mit einer Investitionsoffensive auf Pump, die stark an das spätere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz erinnert. Merz verspottete sie dafür und musste anschließend Werbung dafür machen.
Migration: Einiges ist neu mit Schwarz-Rot. Etwa die Entscheidung, Asylbewerber an deutschen Grenzen zurückzuweisen. Dazu hatte sich die Ampel nicht durchringen können, aus rechtlichen Bedenken - so wie es auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel bis heute vertritt. Zweitens hat sich der Ton geändert. Diese Regierung lässt keinen Zweifel daran, dass sie die Migration begrenzen will. Innenminister Alexander Dobrindt tritt als harter Sheriff an der Grenze auf. Merz hat gar durchblicken lassen, dass er Migranten im Stadtbild für ein Problem hält. Und die Asylbewerberzahlen sinken deutlich.
Das liegt allerdings auch an Entscheidungen der Ampel. An den Kontrollen an allen deutschen Grenzen etwa, die Innenministerin Nancy Faeser zwar letztlich unter öffentlichem Druck, aber eben doch eingeführt hatte. Schon Scholz hatte versprochen, in großem Stil abschieben zu wollen. Daraus wurde zwar nicht viel, aber seine Regierung machte Abschiebungen tatsächlich leichter. Mit Abschiebeflügen nach Afghanistan begann seine Regierung bereits.
Der dritte Punkt betrifft das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), das während der Ampel verhandelt wurde. Kernelement sind Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, die es bislang nicht gibt. Aus Unionssicht standen die Grünen dabei auf der Bremse, die Erleichterungen für Familien mit Kindern in das Ergebnis hineinverhandelten. GEAS tritt erst im kommenden Jahr in Kraft. Aber wenn die Zuwanderung in der Folge weiter nachlässt, werden sich Union und SPD das ans Revers heften. Doch diese umfangreiche europäische Reform stammt eben aus der Ampel-Zeit.
Ukraine: Deutschland hilft weiter der Ukraine und Kanzler Merz wirkt dabei auch entschlossener als sein Vorgänger. Von "Besonnenheit" hört man nicht mehr viel. Doch die Aufrüstung der Bundeswehr ist die logische Konsequenz der "Zeitenwende", die Scholz ausgerufen hatte und mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr untermauert hatte.
Eine Sache, die ein Riesen-Thema für die Union war, ist aber gleichgeblieben: Den Marschflugkörper Taurus liefert Deutschland der Ukraine nicht. Das hatte die Unionsfraktion immer wieder im Bundestag gefordert, auch Merz persönlich. Doch die SPD blieb auch nach der Wahl hart, sagte: Wir liefern den Taurus nicht. Merz beschloss, nicht mehr darüber zu reden, und es sei Russland gegenüber unklug, über konkrete Waffen zu sprechen, die man liefern könnte. Das Ergebnis ist das Gleiche.
Wirtschaftswachstum: Für mehr Wachstum zu sorgen, ist für Merz mit das wichtigste Ziel. Doch er muss mit den gleichen Rahmenbedingungen arbeiten wie die Ampel, eher noch schwierigeren. Zu hohen Energiekosten, Problemen mit China und zu viel Bürokratie kommen noch die Zölle der Trump-Regierung hinzu. Schwarz-Rot greift zu Maßnahmen, die so auch bei Rot-Grün hoch im Kurs standen. Die Grünen warben vor der Wahl mit einer Prämie von 10 Prozent auf inländische Investitionen, was zumindest in eine ähnliche Richtung geht wie die "Turbo-Abschreibungen", die die Union gefordert hatte und die mittlerweile auch umgesetzt wurden. Einen Industriestrompreis hatte die Union vor der Wahl noch abgelehnt. Nun soll er doch kommen. So wie SPD und Grüne ihn gefordert hatten.
Was sich geändert hat oder ändern soll: Es gibt einige Punkte, die die neue Koalition geändert hat oder noch ändern will. Das Heizungsgesetz ist noch in Kraft, soll aber abgeschafft werden. Eine Kindergrundsicherung mitsamt neuer Riesen-Behörde und 5000 Stellen soll es nicht mehr geben. Die von der Union sogenannten "Turbo-Einbürgerungen" nach drei Jahren sind Geschichte. Ansonsten bleibt die Staatsbürgerschaftsreform der Ampel aber intakt. Die Regierung ist gerade dabei, den Kern des Bürgergelds abzuschaffen. Die Vermittlung in Arbeit soll wieder Vorrang haben, Sanktionen wieder härter werden.
Auch das Wahlrecht will Schwarz-Rot noch einmal reformieren. Nach Wunsch der Union sollen künftig die meisten Stimmen in einem Wahlkreis wieder einen Sitz im Bundestag garantieren. Außerdem verfolgt die aktuelle Bundesregierung den Bürokratieabbau und die Digitalisierung noch konsequenter - mit eigenem Ministerium. Das EU-weite De-facto-Verbrennerverbot ab 2035 steht wieder infrage und könnte zumindest gelockert werden. Die Beihilfe zum Agrardiesel, deren Abschaffung zeitweise zu massiven Bauernprotesten geführt hatte, führt Schwarz-Rot wieder ein. Im Klimaschutz regiert ein eher ambitionsschwacher Pragmatismus. Gerade erst wurden die Klimaziele der EU wieder ein Stückchen eingedampft. Während die Erde sich weiter erwärmt.
Und der Streit? Vielen dürfte das ständige Hickhack zwischen Habeck, Lindner und Scholz als Erstes in Erinnerung kommen. Ist das jetzt so anders? Natürlich reiben sich auch Union und SPD aneinander. Der Streit um die Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht ließ schon sehr viel Ampel-Feeling aufkommen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Meist sind sich Union und SPD über die grobe Richtung einig. Sie streiten mehr über das Wie als über das Ob: Wie sehr das Bürgergeld reformiert wird. Ab wann genau eine Wehrpflicht greifen soll. In der Ampel war das anders. SPD und Grüne auf der einen Seite und die FDP auf der anderen zogen irgendwann überhaupt nicht mehr an einem Strang. Stattdessen gab es ein ständiges Tauziehen. Bis das Seil zerriss.
Quelle: ntv.de