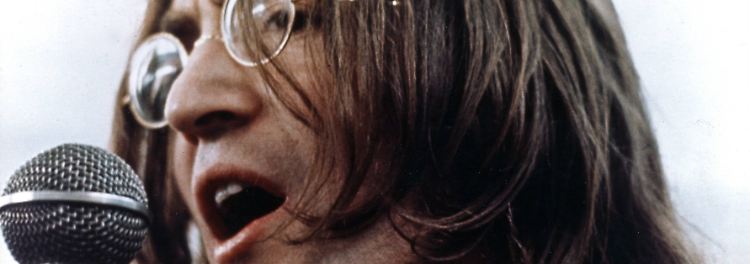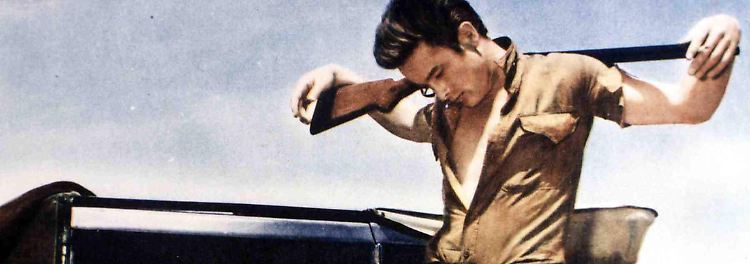Hitlieferant des Barocks Händel 250 Jahre tot
14.04.2009, 09:57 UhrSeine Melodien sind allgegenwärtig wie "Yesterday" und das "Girl von Ipanema": Ob das "Halleluja" aus dem "Messias" oder die Fanfaren der "Wassermusik" - Georg Friedrich Händel (1685-1759) steht ganz oben in der ewigen Hitparade der Klassik. Die Arie "Lascia ch'io piangia" hat Barbra Streisand ins Mikrofon gesäuselt und wer mag, kann sich den Ohrwurm als Klingelton herunterladen. Schon lange vor seinem 250. Todestag am 14. April kam Händel auf allen Kanälen: Aufführungen im Fernsehen, CD-Einspielungen und Biografien - im Jubiläumsjahr wird der Komponist zum Superstar.
Dabei war der Meister aus Halle ein "einsamer Wolf", wie der Musikwissenschaftler Franzpeter Messmer schreibt. In einer neuen Biografie ("Georg Friedrich Händel", Artemis & Winkler) rückt Messmer das Händel-Bild etwas zurecht. Der pummelige Mann, der freundlich aus den Porträtgemälden blickt, war ein von persönlichen Konflikten beladener Mensch. Das Denkmal bekommt dadurch keinen Riss, es wird nur menschlicher.
Flucht vor feudalen Gönnern
Wie kaum ein anderer Komponist der Barockzeit wollte Händel früh die Abhängigkeit von den feudalen Gönnern abschütteln. Vergeblich mühte sich Preußens König Friedrich I., selbst ein begnadeter Flötist, dem jungen Händel eine Ausbildung in Italien zu finanzieren. Händel und sein Vater, von Beruf Barbier und Arzt, schlugen das Angebot aus. Erst Jahre später kam Händel nach Rom - und stieg von dort in die Riege von Europas berühmtesten Komponisten auf.
Sein Zeitgenosse Johann Sebastian Bach (1685-1750) musste sich zeitlebens den Launen bei Hofe und der Willkür der Kirche beugen und verließ nie seine Heimat. Händel entkam in jungen Jahren der Enge der Provinz. Mit untrüglichem Riecher für den Publikumsgeschmack entwickelte er sich vom Hofmusiker zum Musikunternehmer.
Italienischer Klerus beeindruckt
Der Karriereweg führte zunächst nach Hamburg. In Halle an der Saale gab er seine Position als Domorganist auf und ging im Sommer 1703 zunächst als Geiger an das Opernhaus am Gänsemarkt der Hansestadt. Mit Kantaten hatte er sich bis dahin den Ruf als Komponist für Sakralwerke erworben. Nun wollte er sich auch als Schöpfer weltlicher Musik versuchen. Seine erste Oper "Almira" wurde bei der Uraufführung 1705 bejubelt.
In Italien, wohin er 1706 zog, begann Händels Aufstieg zu Europas berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Doch in Rom musste er sich der Allmacht der Kurienkardinäle unterwerfen, die Opernaufführungen verboten hatten. Für die Mäzene aus der Kurie schuf er Dutzende weltlicher Kantaten. Mit Titeln wie "Der Triumph der Zeit und der Enttäuschung", deren Texte oft die Kardinäle selbst verfassten, treten Tugend und Laster als mythische Gestalten gegeneinander an. Händel steuerte den opulenten Klang bei, der Klerus war beeindruckt.
Unabhängigkeit in London
Erst im bürgerlichen London, wo Händel die zweite Hälfte seiner 74 Lebensjahre verbrachte, eröffnete sich ihm die ersehnte Unabhängigkeit. Nach den italienischen Jahren bot ihm die englische Hauptstadt die Chance auf ein weitgehend freibestimmtes Leben. Doch er wurde zwischen seinem Anspruch und den Erwartungen des Publikums zerrieben. Schon früh suchte er dem Erwartungsdruck zu entfliehen - mit Alkohol und reichlich Essen.
Als George Frederic Handel, wie er sich seit seiner Einbürgerung 1727 nannte, komponierte er Opern am laufenden Band. Insgesamt 46 Stücke für das Musiktheater schrieb er - ob Heldensagen wie das Drama des Kreuzfahrers Rinaldo oder "Die Krönung der Popea" - das Londoner Publikum war hingerissen. Händel weigerte sich, im englischen Stil zu komponieren. Als "dramma per musica" hatten seine Werke einen italienischen Einschlag. "Sex und Macht, Eifersucht und Wut, Verzweiflung, Verwünschungen, Tod" - so fasst die amerikanische Krimiautorin und Händel-Begeisterte Donna Leon die "Exzesse" der musikalischen Dramen zusammen.
Adelsoper macht Konkurrenz
Im Frühjahr 1719 gründete Händel ein neues Opernunternehmen am King's Theatre. Für seine neue Royal Academy of Music stellte er eine Sängertruppe zusammen, zu der auch der berühmte Kastrat Senesino gehörte. Zwar feierte Händel mit Opern wie "Giulio Cesare", "Tamerlano" und "Rodelina" rauschende Erfolge. Doch das Publikum wandte sich politisch-satirischen Stoffen zu, wie etwa John Gays "Bettleroper", später Vorbild für Bertolt Brechts "Dreigroschenoper".
Außerdem bekam Händel Konkurrenz von der Gesellschaft "Opera of Nobility", die ihm das gesamte Sängerensemble abwarb. Die Adelsoper engagierte den berühmten Kastraten Farinelli, das Publikum war gespalten. Während etwa der Prince of Wales, Friedrich Ludwig von Hannover, die Adelsoper unterstützte, ergriff Händels Schülerin Prinzessin Ann Partei für Händel. Doch auch der Umzug der Compagnie in das neue Covent Garden konnte den Impresario Händel nicht vor dem Bankrott retten. Mit 52 Jahren stand er vor einem Scherbenhaufen. Ein Schlaganfall lähmte ihn für Monate.
Zu letzt Erfolg mit Oratorien
Aber Händel hatte musikalisch vorgesorgt. Er hatte sich mit der Kunst der Oratorien beschäftigt. Wie in der Oper ließ Händel die Sänger vor dem Orchester aufstellen und auf Englisch singen. Mit Hilfe seines Librettisten Charles Jennens knüpfte er wieder an frühere Erfolge an: Oratorien wie "Israel in Egypt" oder "Saul" wurden zu Publikumsrennern, auch weil sie gekonnt mit der Rivalität zwischen Katholiken und Anglikanern spielten.
Für sein wohl berühmtestes Werk brauchte Händel kaum mehr als drei Wochen. Jennens musste ihn aber zunächst dazu überreden, denn Händel wollte eigentlich nicht mehr komponieren. Nach der Uraufführung in Dublin erklang der "Messias" im März 1743 erstmals in London. Zunehmend geplagt von einer schleichenden Erblindung, zog sich Händel privat immer mehr zurück. Aber noch eine Woche vor seinem Tod am 14. April 1759 saß er bei einer Aufführung des "Messias" an der Orgel.
Quelle: ntv.de, Esteban Engel, dpa