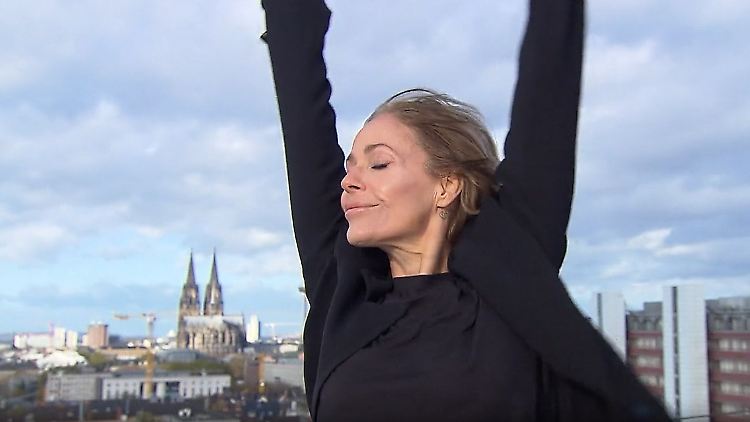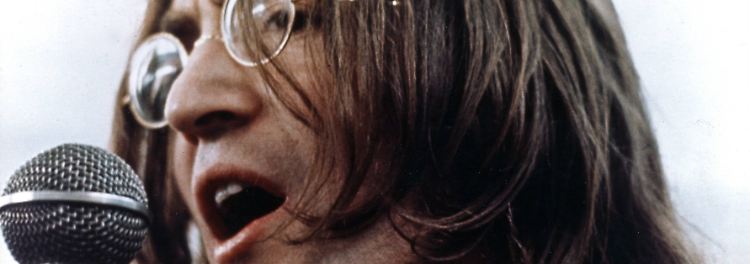Wunschvorstellung oder realistische Perspektive? Demokratie in Asien
24.11.2007, 15:39 UhrBei den periodisch in Vorstandsetagen vorgenommenen Abwägungen über die Vorzüge einzelner Produktionsstandorte spielt die Stabilität des jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Umfelds keine ganz unwesentliche Rolle. Rechtssicherheit, eine niedrige Kriminalitäts- und Korruptionsrate sowie eine intakte markwirtschaftliche Ordnung gehören dabei ganz sicher zu den Pluspunkten. Diese zivilisatorischen Errungenschaften dürften sich erfahrungsgemäß zuvorderst in demokratischen Systemen einer besonderen Wertschätzung erfreuen.
Wie aber steht es um die Demokratie in Asien, dem bevorzugten Erdteil für Produktionsverlagerungen? Auf jeden Fall hat der "Wind of Change" der Jahre 1990 ff. die dortigen politischen Verhältnisse gehörig durcheinander gewirbelt, hat es flächendeckend – von Kathmandu über Phnom Penh bis Dili – signifikante demokratische Transformationsprozesse gegeben.
Demokratie als universaler Wert
Beträchtliche Zweifel bestehen indes bei der Frage, wie tief gehend und vor allem wie nachhaltig dieser Trend ist. Als außerordentlich diffizil erweist sich dabei, dass weiterhin unklar ist, ob – und wenn ja, inwiefern – die Begriffe Staat und Demokratie überhaupt auf Asien übertragbar sind. Vielleicht gebiert der sprichwörtliche asiatische Pragmatismus ja eine eigene, genuine Form von "Gutem Regieren".
Den Versuch einer Antwort auf diesen Themenkomplex gibt nun ein Sammelband, der die Ergebnisse der hochkarätig besetzten "Weingartener Asiengespräche" der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart aus dem Jahr 2005 zusammenfasst.
Im programmatischen Einführungskapitel wird zunächst ein plausibler analytischer Kompass entwickelt: Zwar seien Staat und Demokratie Ordnungsprinzipien, die im engen Zusammenhang mit einer sehr spezifischen westlichen Geschichte stehen und demzufolge Traditionslinien markieren, die den asiatischen Staaten weit gehend fehlen. Andererseits habe der Prozess der Globalisierung westliche Vorstellungen partiell universalisiert. Diese bilden mithin so etwas wie einen formativen globalen Referenzpunkt – auch für Asien. Von Colombo bis Tokio wird Politik real in den besagten Kategorien gedacht und praktiziert. Mehr noch: Modernisierungskalküle führten dort sukzessive zu einer technokratischen Einfärbung der Politik und damit zu einer anwachsenden Professionalisierung.
Jedoch: Der Durchbruch zur Demokratie westlicher Provenienz wird deshalb keineswegs zu einer bloßen Frage der Zeit. Vielmehr ist ein je verschiedenartiger "kultureller Rest" in Rechnung zu stellen, der sich auf die Art der Entscheidungsfindung, traditionelle Vorstellungen von sozialer Balance oder auf das Austarieren des Spannungsverhältnisses zwischen Gruppe und Individuum beziehen kann. Eben die Existenz derartiger "unique pattern" lässt für die Autoren maximal die Perspektive eines "liberalen Konstitutionalismus" als realistisch erscheinen, bei dem aber immerhin Transparenz und Berechenbarkeit gewährleistet werden.
Fusion der Zivilisationen
Diese Einschätzungen werden in den sich anschließenden Fallstudien detailliert belegt: Als konsolidierte Demokratien können einzig Japan und Indien gelten. Auch bei ökonomischem Fortschritt stellt sich politische Offenheit, wie in Malaysia und in Singapur zu besichtigen, nicht zwangsläufig ein. In Thailand und auf den Philippinen gibt es zwar ermutigende Entwicklungen; Regressionen bleiben aber jederzeit möglich. Kaum demokratische Tendenzen sind hingegen in Brunei und in Indonesien auszumachen – von den letzten kommunistischen Ländern VR China, Vietnam, Laos, Nordkorea und dem renitenten Burma ganz zu schweigen. Lediglich Südkorea und Taiwan können als aussichtsreiche Demokratie-Kandidaten gelten.
Gleichwohl sind zivilgesellschaftliche, perspektivisch auf Partizipation abzielende Dynamiken asienweit unübersehbar. Zudem setzt sich bei immer breiteren Bevölkerungsschichten die Erwartung durch, beim demokratiebezogenen internationalen Benchmarking nicht ins Hintertreffen zu geraten und als "Ewiggestrige" stigmatisiert zu werden. Am Ende eines langen, widersprüchlichen Prozesses könnte daher – so die Botschaft der Autoren – eine asiatische Demokratie stehen, die sich durch eine Verschmelzung kultureller Eigenheiten und westlich-liberaler Ideen kennzeichnet. Als winning formula für das 21. Jahrhundert könnte sich somit eine "Fusion der Zivilisationen" herausstellen.
Obwohl es sich bei dem Band um eine typisch akademische Hervorbringung handelt, haben sich die Autoren dennoch bemüht, ihre Ausführungen betont verständlich zu halten und auf gewundenes Wissenschafts-Latein größtenteils zu verzichten. So wird auch Fachfremden die Möglichkeit geboten, sich zu diesem elementaren und dabei doch chronisch unterreflektierten Thema eine begründete Meinung zu bilden.
Daniel Müller
Jörn Dosch, Manfred Mols, Rainer Öhlschläger (Hrsg.), Staat und Demokratie in Asien. Zur politischen Transformation einer Weltregion, LIT Verlag, Berlin 2007, 216 Seiten, 19,90 Euro
Quelle: ntv.de