Buchpreis-Sieger mit SchwächeSo etwas würde ein Love-Scammer doch nicht sagen, oder?
 Von Sarah Platz
Von Sarah Platz 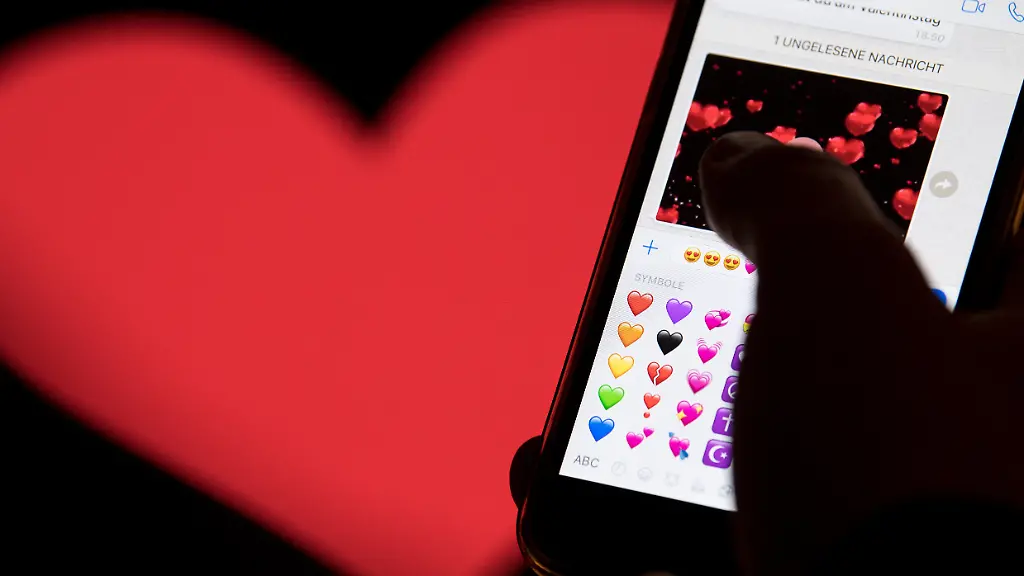
Der Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" gewinnt den Buchpreis 2024. Fast tänzerisch erzählt Martina Hefter die merkwürdige Dreiecksbeziehung zwischen Juno, ihrem schwerkranken Ehemann Jupiter und Benu, einem Liebesbetrüger aus Nigeria. Doch die Schrittfolge der Autorin ist oft zu schnell.
Gewissermaßen steckt Juno in einer Dreiecksbeziehung. Mit ihrem an Multiple Sklerose erkrankten Ehemann Jupiter, der sie ebenso in- und auswendig kennt wie sie ihn, teilt sie die in die Jahre gekommene Wohnung im Leipziger Westen sowie ihre Vergangenheit. Benu hingegen platzt als abgedroschenes Kompliment auf Instagram in ihr Leben. Für den Liebesbetrüger, der über 6000 Kilometer entfernt in einer Kleinstadt in Nigeria lebt, ist die Mitte 50-Jährige in diesem Moment kaum mehr als ein Geschäftsmodell. Juno wiederum nutzt den 32-Jährigen als digitale Belustigung in einer schlaflosen Nacht. Ihr Kontakt ist damit maximal austauschbar - zumindest anfangs.
"Es stellt sich die Frage, wer hier wen ausbeutet - und was passiert, wenn wider Erwarten die Grenzen zwischen digitalem Spiel und realer Zuneigung verschwimmen", schreibt die Jury des Deutschen Buchpreises über den diesjährigen ersten Platz "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". In ihrem vierten Roman, der als Hörbuch im Argon-Verlag erschienen ist, setzt Martina Hefter ihren Hörerinnen und Hörern die Brille ihrer Protagonistin, Juno Isabella Flock, auf. Dann geht es im Schnellschritt durch ihr mit Hindernissen gespicktes Leben. Die Jury fasst ihre Faszination für Hefters Werk so zusammen: Der Autorin sei es gelungen, den "zermürbenden Alltag" mit "kosmischen Elementen" zu verbinden.
So bedeutet Junos Alltag in erster Linie die Pflege ihres schwer kranken Mannes. Jupiter, sein Leben lang Schriftsteller, ist zum einen auf Rollstuhl und Pflegebett und zum anderen auf seine Frau angewiesen. Zwar klammert er sich an jeden Millimeter seines schwindenden Bewegungsradius, vor allem für und vor Juno. Doch wissen sie beide, dass schon das Halten des Buttermessers eine kaum vergleichbare Kraftanstrengung für ihn darstellt. Seine Schuhe kann er schon jetzt nicht mehr alleine binden und die eben einsetzenden Zahnschmerzen deuten auf einen neuen Schub hin.
Tanzen bis zum Tod
Außerdem braucht Jupiter jeden Tag eine Spritze mit Copaxone, um zu überleben. Er kann sie sich selbst setzen, aber ob er das Mittel erhält, hängt vor allem davon ab, ob Juno seine Versicherungskarte rechtzeitig zur Post bringt. Etliche Male hat Juno das bereits erwogen, 5475 Spritzen waren es seit 2008. Kurz gesagt: Jupiters Alltag kreist um seine Krankheit, mehr und mehr wird die kleine Hochparterre-Wohnung zu seinem Universum. Und weil Juno, ganz zwangsläufig, um Jupiter kreist, zieht sich auch ihr Horizont mit jedem Schub etwas weiter zusammen.
Dabei platzt Juno förmlich vor Bewegungsdrang. Jeden Abend liegt sie auf dem Boden ihres Zimmers, macht Kraftübungen und dehnt anschließend Muskel für Muskel ihres Körpers. Seit Kindheitstagen tanzt sie Ballett. Ihr schlechter Orientierungssinn kostete sie zwar die große Tanzkarriere, ihr Geld - "mal mehr, mal weniger" - verdient sie trotzdem als freischaffende Performance-Künstlerin. Am liebsten würde Juno bis zu ihrem Lebensende tanzen, "und dann tot umfallen ohne großen Beef".
Der Ballettsaal und die Bühne bedeuten für Juno Freiheit - und Flucht. Flucht aus einem immer weiter schrumpfenden Universum. Flucht aus einer Beziehung, deren Liebe durchaus ungebrochen ist, die sich aber schon lange auf getrennte Schlafzimmer und ein paar hastig ausgetauschte Sätze im Alltag beschränkt. Und Flucht vor der Last der Verantwortung für gleich zwei Leben. Was Jupiter nicht mehr schafft, übernimmt Juno. An das Einfangen und Heraustragen von Spinnen aus der Wohnung hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Nur beim Müll Rausbringen schießt es ihr manchmal blitzartig durch den Kopf: "Juno hasst es, dass immer nur sie den Müll rausbringt, nie Jupiter. Juno hasst sich dafür, dass sie das hasst." Momente, in denen Juno - wenn auch kaum spürbar - die Fassung verliert, sich für Sekundenbruchteile gestattet, gereizt zu sein, sind selten. Umso stärker bleiben sie der Hörerin im Kopf.
"Hi Schönste, hi Sonnenschein"
Denn Juno, das ist auf langer Strecke die stets taffe und liebevolle Frau aus dem Leipziger Westen. Eine, die nicht aufhört, sich neue Tattoos stechen zu lassen, die mitten auf dem Bahnsteig unüberhörbar für mehr Barrierefreiheit protestiert und die es bei keinem Einkauf versäumt, die von Jupiter geliebten Pizzazungen auf das Kassenband zu legen. Unterkriegen kann Juno, so scheint es, rein gar nichts. Weder die finanziellen Durststrecken, in denen sie schon einmal tagelang nichts anderes als Käsebrot mit Strauchtomaten essen. Noch ihr Alter, das von ihrer Umgebung ganz offensichtlich strenger beäugt wird, als von Juno selbst.
Und doch gibt es eine kaum zu leugnende Lücke in ihrem Leben. Da ist etwas, das in Juno rattert, ihr Nacht für Nacht den Schlaf raubt. Wenn sie dann wach daliegt, wird ihr Posteingang auf Instagram zum Ventil. Juno wartet förmlich auf das "Pling", mit dem sich Accounts wie "JimmiTaylor_354" in ihr Leben schleichen wollen. "Hi Schönste, hi Sonnenschein", schreiben sie. Oder "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Auf den Fotos der Accounts sind oft weiße Männer mittleren Alters zu sehen, Geschäftsmänner, graumeliert mit charmantem Blick. In Wahrheit stecken meist junge Männer, oft aus afrikanischen Ländern, etwa Ghana oder Nigeria, hinter den Profilen.
Love-Scammer, Liebesbetrüger, werden sie genannt. Eine Art digitale Heiratsschwindler, die ihren liebeshungrigen Opfern große Gefühle vorgaukeln, bevor sie urplötzlich in eine kostspielige Katastrophe, etwa einen Autounfall oder eine notwendige Operation, geraten. Retten kann sie dann angeblich nur noch eine saftige Überweisung per Western Union. Juno hatte Fernsehreportagen über Frauen gesehen, die auf diesem Wege ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Im Interview mit "Spiegel TV" gab einer der Scammer mal an, er sehe seine Opfer als "Erbinnen der europäischen Kolonialherrschaft über Afrika".
Als Benu entlarvt wird
In vollem Bewusstsein darüber, wer hinter den schnulzigen Komplimenten in ihrem Nachrichteneingang steckt, könnte Juno sie ignorieren, im besten Fall direkt blockieren. Stattdessen verbringt sie ganze Nächte damit, zu antworten, oder besser: zu lügen. Sie schreibt, sie sei Rumänin, besitze drei Falken, "jeder 20.000 Dollar wert" und dass sie Geldscheine rauche. Die Hörerinnen und Hörer lernen Juno in diesen Nächten von einer anderen Seite kennen, von einer überheblichen, fast unsympathischen, manchmal unterschwellig aggressiven Seite. Tut sie das, um all die belogenen Frauen zu rächen? Um den jungen Männern eins auszuwischen? Aus Spaß? Junos Gedanken kreisen um eine passende Antwort und damit auch die der Hörerinnen und Hörer.
Kommen die Scammer hinter Junos Lügenkonstrukt, beenden sie den Chat und blockieren ihren Kontakt. Bei "Owen_Wilson223" ist das allerdings anders. Zwar hatte Juno den angeblichen Ukrainer, der es in Texas zu Großem gebracht hat, schnell als 32-jährigen Benu aus Nigeria entlarvt. Doch Benu ist geblieben. Und mehr noch: Benu und Juno beginnen, sich bei Whatsapp zu schreiben, Nacht für Nacht, manchmal telefonieren sie sogar per Videochat.
Einmal sagt Benu, Juno sehe aus "wie ein Kobald". Ein anderes Mal: "Ich gebe einen Scheiß auf Deutschland." Juno beruhigt das, denn so etwas würde ein Love-Scammer doch nicht sagen, oder? Was genau Benu von Juno will, bleibt ein Rätsel. Umso offensichtlicher ist jedoch, dass Juno die Aufmerksamkeit - das womöglich echte Interesse - genießt. Er fragt sie, wie ihr Tag war, was sie heute gedacht hat, und sie erzählt ihm von ihrem Lieblingsfilm. Obwohl sich ihre Gespräche meist auf oberflächliche Themen beschränken und nicht selten mit kulturellen Missverständnissen gespickt sind, stecken sie doch voller Intimität.
Leichtfüßig durch schwere Themen
Trotz reiner Digitalität wirken die Chats zwischen Benu und Juno so vertraut auf die Hörerinnen und Hörer wie kaum eine andere Passage des Buches. Das liegt zum einen an Hefters Feingefühl, mit denen sie die knappen, oft mit Emojis durchzogenen Dialoge beschreibt. Zum anderen ist Inka Löwendorf als Sprecherin des Romans an diesen Stellen besonders stark: Während die Schauspielerin größtenteils sachlich und klar liest, erhält Benu einen naiven, manchmal fast traurigen Unterton. In Junos Stimme hingegen ist das Rattern ihrer Gedanken förmlich zu hören. Hinzu kommt eine nie ganz verschwindende Prise Optimismus.
Hefter erzählt Junos Zwiespalt, diese merkwürdige Form der Dreiecksbeziehung, auf gleichermaßen eindringliche wie souveräne Weise. Sie lässt ihre Hörerinnen und Hörer Junos Bedürfnisse und Sehnsüchte spüren, ohne sie zu benennen. Eine Geschichte um zwei Männer, eine Frau, Liebe, Distanz und Verantwortung birgt zumindest das Risiko, in Kitsch oder Tragik abzurutschen. Doch nichts davon findet sich in diesem Roman, im Gegenteil. Hefter lässt an den richtigen Stellen Ironie walten. Den durchaus zermürbenden Alltag des Ehepaares lockert sie mit Alltagsbeobachtungen auf, etwa das jährliche Gezeter der jüngeren Generationen, wenn die Älteren schon im September zum soeben aufgestellten Spekulatius im Supermarkt greifen.
Spektakulär ist vor allem das, was die Buchpreis-Jury als "klug durchchoreografiert" bezeichnet. So dürfte es vielen schwerfallen, große Themen wie die Sehnsüchte einer Frau in den Fünfzigern, Love-Scamming und die Hürden eines Lebens mit MS zu einer plausiblen Geschichte zu verknüpfen. Hefters Roman aber wirkt weder widersprüchlich noch konstruiert. Vielmehr tanzt sie durch die Themen, passt Junos springende Gedanken den verschiedenen Rollen und Situationen an, in denen sie sich nun einmal befindet. Möglicherweise kommt Hefter hierbei ihre eigene Biografie zugute - sie selbst ist Tänzerin, sie selbst pflegt ihren an MS erkrankten Ehemann. In ihrem Roman spielt die Leipzigerin mit Autofiktion. Es habe ihr "Spaß gemacht, zu schauen, wie weit ich meine eigene Biografie biegen kann", sagte Hefter einmal im "Spiegel".
Der Wunsch nach mehr
Vielleicht drängt sich der Hörerin gerade deshalb an vielen Stellen der Wunsch nach mehr Tiefe auf. So wirkt Junos Gedankenchaos zwar realitätsnah. Oft reißt es den Hörer allerdings gerade dann aus der Szenerie, wenn es spannend wird. Themen wie Alltagsrassismus, Altersdiskriminierung, das politische System in Nigeria und Ballett als "stärkste Kolonialmacht" werden aufgeworfen. Wenige Sekunden später verpuffen sie jedoch als reiner Nebensatz, der vom Hörer kaum aufgenommen, gar verarbeitet werden kann.
Stattdessen bringt Hefter viel Zeit dafür auf, über Junos Lieblingsfilm "Melancholia" und Insektenhotels auf Fensterbänken zu schreiben. Das mag ihre Protagonistin beschäftigen. Doch gerade in diesen eher langatmigen Passagen wächst der Wunsch der Hörerin, mehr über Junos Empfinden oder Nicht-Empfinden für Benu - möglicherweise sogar seine Perspektive - zu erfahren.
Sicherlich wäre Hefter dies mit Leichtigkeit gelungen. Aber die Choreografie ihres Romans kennt nun einmal keine Pause. Damit wird die Stärke von "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" gleichzeitig zu seiner Schwäche: Hefters literarische Schrittfolge ist beeindruckend und einzigartig - und doch an vielen Stellen zu schnell.
