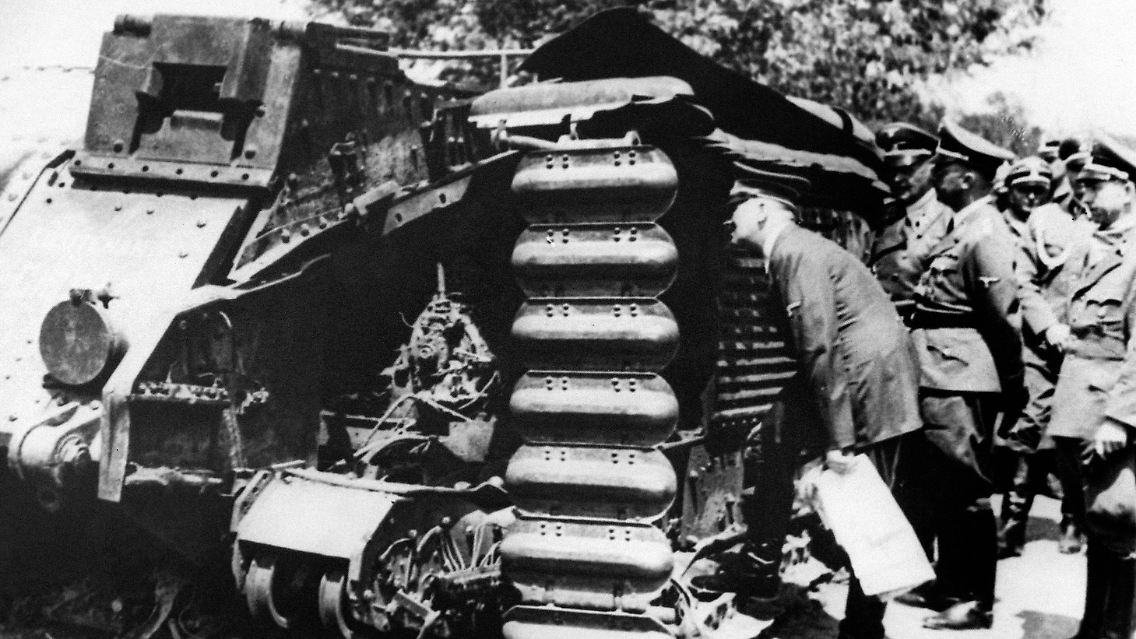Der Rotarmist am Tag des Sieges Wenn der Feind dem Bruder gleicht
09.05.2015, 09:51 Uhr
Nemenskij (Mitte) mit anderen Rotarmisten vor dem Brandenburger Tor in Berlin.
Als die Deutschen die Sowjetunion überfallen, zögert Boris Nemenskij nicht lange und meldet sich freiwillig zur Roten Armee. Er kommt an die Front, sieht alle Schrecken des Krieges - und greift zu einer ganz speziellen Waffe.
Es ist ein friedlicher Frühlingstag. Die Sonne scheint, als Boris Nemenskij im Schatten des Berliner Doms sitzt und seinen Skizzenblock herausholt. "Ich habe die Stille gezeichnet", sagt er später. Die Stille in einem Meer von Trümmern und Ruinen, die Reste der verwüsteten Hauptstadt Nazideutschlands. Es ist der 9. Mai 1945, der Tag des Sieges für die Sowjetunion.
Mehr als zwei Skizzen schafft Nemenskij an diesem Tag nicht. Wenig später trinkt er mit anderen sowjetischen Soldaten den ersten Wein, aus dem ganzen Umland kommen sie, um den Tag der Tage in Berlin zu feiern. Danach zieht er mit Kameraden aus seiner Einheit – alles Künstler, die als Kriegskorrespondenten und Agitatoren arbeiten - zum Brandenburg Tor. Hier trinken und feiern sie weiter und werden so laut, dass sie zur Stadtkommandantur gebracht werden. Als man dort erfährt, dass sie Künstler aus Moskau sind, gibt es wieder Wein. Schließlich herrscht nach fast sechs Jahren des Tötens endlich Frieden in Europa.
Beim Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion im Juni 1941 studierte Nemenskij noch Kunst an der Hochschule. Ein Jahr später - die Deutschen halten inzwischen große Teile seines Landes besetzt - steht er vor der Wahl: Entweder macht er seine Ausbildung in Samarkand weiter oder er geht an die Front. Für ihn ist klar: "Ein normaler Mann muss an die Front, muss sein Vaterland verteidigen."
Der 19-Jährige zieht in den Krieg. Doch er schießt und tötet nicht. Er kommt zu einer Einheit von 30 Künstlern, die als Kriegskorrespondenten mit Skizzen die Schrecken des Krieges festhalten. Dafür bereist Nemenskij weite Teile der Front, er sieht die Kämpfe vor Moskau und Leningrad, bei Kalinin, Smolensk, in der Ukraine und Weißrussland, an der Oder und in Berlin. Um ihn herum sterben Menschen oder werden schwer verwundet – und seine Aufgabe ist es, das zu zeichnen.
Schnell ändert sich im Krieg sein Bild der Deutschen. Als er an die Front kam, hielt er diese noch für eines der zivilisiertesten Völker der Welt. Nemenskij, der in der Schule Deutsch gelernt hatte, verbindet sie mit Bach und Goethe – und nicht mit Adolf Hitler. Doch an der Front wächst seine Wut. Er sieht die Spuren des deutschen Vernichtungsfeldzugs, die Trümmer, die Toten und Verletzten. "Das Schlimmste war zu beobachten, wenn Menschen starben, Soldaten wie Zivilisten", sagt er heute.
Im weißrussischen Welikije Luki, inmitten der völlig zerstörten menschenleeren Stadt, entdecken die Soldaten der Roten Armee Anja, ein kleines Mädchen mit dem Gesicht einer alten erschöpften Frau. "Die Soldaten, die selbst ihre eigenen Kinder vermissten und sich um sie sorgten, haben sich wie Väter um sie gekümmert", so Nemenskij. Später stoßen sie noch auf viele solcher Waisen, deren Verwandte im Krieg getötet worden waren.
"Faschisten mussten doch anders aussehen"

Nemenskij vor dem Bild "Das sind wir, Herr" bei einer Ausstellung seiner Werke im Russischen Haus in Berlin.
(Foto: n-tv.de)
Einmal will er sich an der Front bei Dunkelheit erschöpft auf einem Baumstumpf ausruhen. Doch als er sich setzt, stellt er fest: Es ist kein Baumstumpf, sondern ein deutscher Soldat. Er ist tot und noch warm. Nemenskij dreht ihn um - es ist der erste deutsche Tote, dem er so nah ins Gesicht guckt - und bestürzt stellt er fest: Der Deutsche ist ein Junge, er hat ein kindliches Gesicht mit roten Haaren. "Er ähnelte mir, als wäre er mein Bruder", sagt er. "Das war für mich ein Schock. Faschisten mussten doch anders aussehen."
Als er im April 1945 ins brennende Berlin vorrückt, lernt er mehr Deutsche kennen. Sie sind, so erinnert er sich 70 Jahre später mit leichter Belustigung, immer äußerst höflich, gehorsam und fleißig, sie ziehen die Hüte vor den Siegern. Es ist offensichtlich: "Sie hatten Angst vor uns russischen Barbaren." Nemenskij wird in einer deutschen Familie einquartiert, die Töchter bringen ihm Tanzen bei, er malt sie auf ihrem Balkon, im Hintergrund steht eine Kirche. Und er stellt fest: Auch die Deutschen sind Menschen.
Als Nemenskij Ende Mai nach Moskau zurückkehrt, wird ihn der Krieg so schnell nicht loslassen. Schließlich liegt sein Land in Trümmern, rund 27 Millionen Einwohner der Sowjetunion sind im Krieg umgekommen, fast drei Millionen Rotarmisten starben in deutscher Gefangenschaft. Aus seiner Klasse haben nur ein anderer Junge und er überlebt. Noch lange hat er Albträume, die Fragen verfolgen ihn: Wieso wollten junge Männer sein Land erobern? Warum bringen sich Menschen gegenseitig um? Und wie kann er den Hass aus seinem Herzen reißen?
Ihm gelingt es, indem er zum Pinsel greift. Immer wieder malt er das Grauen des Krieges, den toten rothaarigen Deutschen. In Nemenskijs Bildern liegt der Deutsche neben einem jungen getöteten Russen, ihre Haare berühren sich, ein Gewehr und ein Messer an ihrer Seite. Ständig überarbeitet Nemenski das Bild, malt neue Varianten - und verliert nach und nach seinen Hass.
In diesem Jahr feiert er den 9. Mai wieder in Berlin, ohne Uniform, dafür mit Frau und Sohn. Statt zu malen, stellt er hier diesmal seine Bilder des Krieges aus. Nach 70 Jahren ist es das erste Mal, dass er in die deutsche Hauptstadt zurückkehrt. Die Stadt erkennt er nicht mehr. Doch wie damals spürt er vor allem Erleichterung, darüber, dass der Krieg vorbei ist. Dass er noch lebt. Er ist der Letzte aus seiner Einheit.
Nemenskijs Bilder sind im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin bis zum 30. Mai ausgestellt.
Quelle: ntv.de