"Raum für Steuervermeidung" Karlsruhe stellt Privilegien infrage
08.07.2014, 16:20 Uhr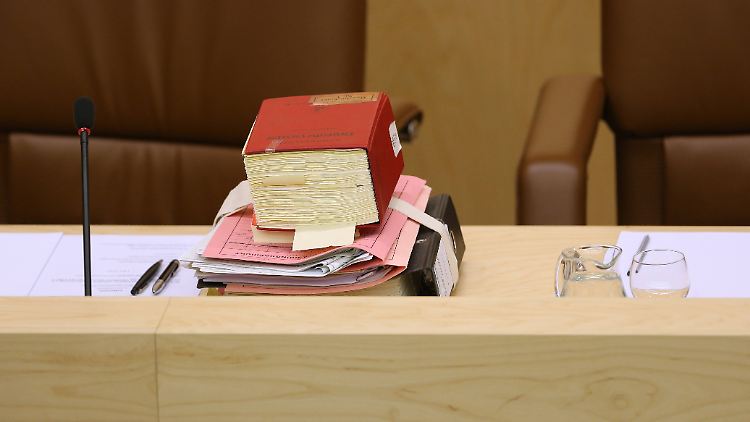
(Foto: imago/Stockhoff)
Das Bundesverfassungsgericht prüft den Erbschaftssteuer-Erlass für Familienunternehmen. Nach der mündlichen Verhandlung sieht es so aus, als müssten Mittelständler um ihre Vorteile bangen.
Das Bundesverfassungsgericht zweifelt an den Steuerprivilegien für Unternehmenserben. In der mündlichen Verhandlung am heutigen Dienstag stellte der Erste Senat vor allem das Ausmaß der Verschonung infrage. Gerichtsvizepräsident Ferdinand Kirchhof sagte, die seit 2009 geltenden Regelungen öffneten "einen breiten Raum für eine Steuervermeidung bis hin zur völligen Steuerbefreiung". Mehrere Richter fragten zudem, ob der Gesetzgeber bei der Erbschaftsteuer nicht über das Ziel hinausgeschossen sei und man nicht von einer Überprivilegierung von Unternehmenserben gegenüber anderen Steuerzahlern sprechen könne.
Das Gericht muss entscheiden, ob die Besserstellung von Unternehmenserben gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung im Grundgesetz verstößt. Geprüft wird, ob Steuerpflichtige, die keine Vergünstigungen beanspruchen können, in ihrem Recht auf eine gleichmäßige und der Leistungsfähigkeit entsprechenden Besteuerung verletzt werden. Das Urteil könnte im Herbst fallen. Bei den rund drei Millionen Familienunternehmen in Deutschland wird die Entscheidung mit großer Spannung erwartet (Aktenzeichen: 1 BvL 21/12).
Steuererlass für sichere Arbeitsplätze
Die aktuelle Regelung entlastet Erbschaften dann, wenn im Zuge des Betriebsübergangs die Arbeitsplätze weitgehend gesichert werden. Wer den Betrieb fünf Jahre lang fortführt und die Lohnsumme in dem Zeitraum weitgehend stabil hält, bekommt schrittweise 85 Prozent der Steuerschuld erlassen. Wer sieben Jahre schafft, muss am Ende keine Steuer bezahlen. Die Lohnklausel gilt allerdings nur für Unternehmen mit über 20 Beschäftigten.
Die Bundesregierung begründete in Karlsruhe die Entlastungen mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister, sagte, der Gesetzgeber habe dabei seinen Gestaltungsspielraum genutzt. Es sei Ende 2008 bei der Schaffung der Regelung angesichts der damaligen Wirtschaftskrise darum gegangen, "die Arbeitsplatzbeschaffer in der deutschen Wirtschaft nicht weiter zu belasten".
Meister verwies darauf, dass über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland in Familienbesitz sind. Gerade in Zeiten weltweiter Umbrüche gehe es um den Erhalt der deutschen Wirtschaftsstruktur. Die Erbschaftsteuer bringe dem Staat lediglich 4,5 Milliarden Euro im Jahr und damit weniger als ein Prozent des gesamten Steueraufkommens ein.
Zielgenau und dem Gemeinwohl dienlich?
Der Erste Senat entscheidet über eine Vorlage des Bundesfinanzhofs. Der hält die seit 2009 geltenden Regelungen für verfassungswidrig. Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermögen sei eine unzulässige "Überprivilegierung" gegenüber Privatvermögen, meinten die Münchner Finanzrichter. Die derzeitigen Regeln gelten als missbrauchsanfällig.
Generell müssen Verschonungsregeln dem Gemeinwohl dienen und "zielgenau" sein. Das Verfassungsgericht prüft deshalb nun, ob die Privilegierung von Firmenerben mit dem Verweis auf das Gemeinwohl gerechtfertigt ist und ob eine stärkere Belastung die Betriebe tatsächlich gefährden würde. Der Berichterstatter des Karlsruher Verfahrens, Michael Eichberger, weist auf einen weiteren zentralen Punkt hin: "Darf die Steuerverschonung gewährt werden, ohne eine individuelle Prüfung, ob das Unternehmen überhaupt der Verschonung bedarf?"
Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber, warnte: "Sollte die geltende Regelung gekippt werden, droht vielen Familienunternehmen ein Ausverkauf." So würden Familienunternehmen bei der Festsetzung der Steuer regelmäßig überbewertet. Erst die Verschonungsregelungen glichen diesen Nachteil aus. Sie dienten dem Erhalt von Arbeitsplätzen in den mittelständischen Unternehmen. Für die vielen Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern sind die Vergünstigungen aber schon heute problematisch. Denn für die meisten von ihnen ist die zentrale Bedingung der Begünstigung, die Lohnsummenregel, nicht anwendbar.
Nach der mündlichen Verhandlung werden noch einige Monate vergehen, bis die Verfassungsrichter ihr Urteil verkünden. Möglich ist eine Bestätigung des Gesetzes. Es könnte auch eine "Ja, aber"-Entscheidung geben, quasi ein "Bis-hier-und-nicht-weiter"-Urteil mit Auflagen.
Bei einer "Nein, aber"-Entscheidung würde das Gesetz als unvereinbar mit dem Grundgesetz, jedoch reparabel eingestuft. Würde das Gesetz tatsächlich gekippt, dürfte das die Unternehmen aber nicht über Nacht in großem Stil in ihrer Existenz gefährden. Familienunternehmer würden dann aber abhängiger von fremden Kapitalgebern. Möglicherweise könnten die Firmenerben dann aber auch von niedrigeren Steuertarifen profitieren.
Quelle: ntv.de, ino/dpa/rts





