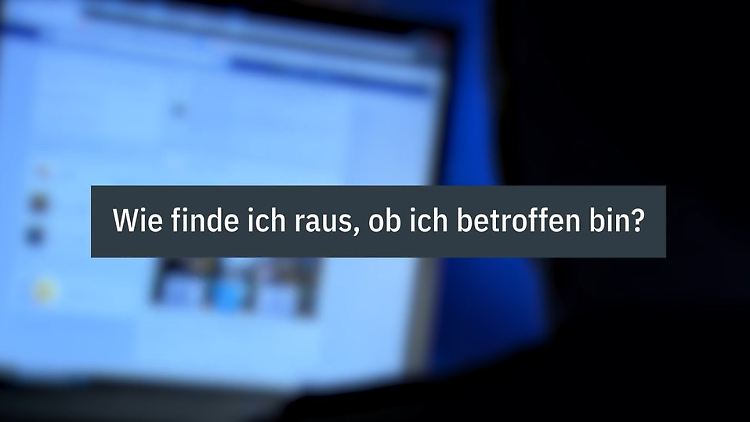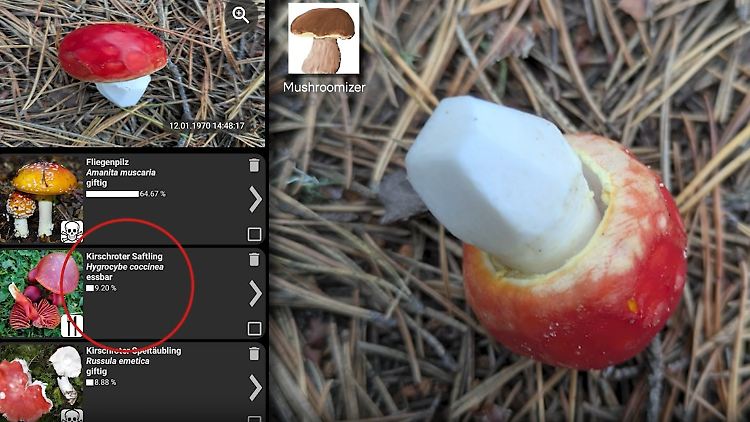Nicht immer darf man schweigen Strafanzeige stellen - so geht's
22.07.2016, 16:29 Uhr
Die Polizei ist meist die erste Anlaufstelle für Strafanzeigen.
(Foto: dpa-tmn)
Egal, ob Fahrraddiebstahl, Betrug oder Nötigung - wer Opfer oder Zeuge von kriminellen Handlungen wird, kann Strafanzeige stellen. In manchen Fällen ist man sogar dazu verpflichtet. Wie geht man vor und wann ist die Anzeige eine schlechte Idee?
Ein Fremder hat die Beifahrertür des Autos demoliert, man wurde beraubt oder ein Geschäftspartner dreht krumme Dinger - in solchen Fällen können Betroffene oder Zeugen eine Strafanzeige stellen. Doch im schlimmsten Fall kann das nach hinten losgehen. Das zeigt der Fall von Gina-Lisa Lohfink, die sich nach einer Strafanzeige wegen Vergewaltigung am Ende selbst auf der Anklagebank wiederfand. Wer sich unsicher ist, ob eine Anzeige der richtige Weg ist, kann sich an die Polizei wenden und gegebenenfalls nur einen "Hinweis" geben.
"Eine Strafanzeige ist prinzipiell dann möglich, wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung besteht". Das sagt Prof. Heiko Ahlbrecht, Fachanwalt für Strafrecht in Düsseldorf. Niemand gesetzlich dazu verpflichtet, eine Strafanzeige zu erstatten. Eine Ausnahme: Es geht um schwere Straftaten, die man verhindern könnte. Wer von einem geplanten Raub, einem Mord oder einer Erpressung Wind bekommt, muss das der Polizei mitteilen, so steht es in Paragraf 138 des Strafgesetzbuchs. Andernfalls droht dem Zeugen unter Umständen eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Auch wenn der Täter vielleicht nie ermittelt wird, könne der Schritt allein aus versicherungsrechtlichen Verpflichtungen geboten sein, sagt Ahlbrecht.
Vorsicht mit falschen Verdächtigungen
Strafanzeige können sowohl Opfer als auch Zeugen stellen. Ganz wichtig: Eine einmal erstattete Strafanzeige lässt sich nicht mehr zurückziehen. Der Schritt sollte also wohlüberlegt sein, sagt Kerstin Backofen von der Stiftung Warentest. "Schließlich handelt es sich um einen schwerwiegenden Eingriff in den persönlichen Lebensbereich anderer Menschen."
Wer zu Unrecht eine bestimmte Person anzeigt, muss mit harten Konsequenzen rechnen - jedenfalls dann, wenn er wider besseres Wissen gehandelt hat. "Dies kann als strafbare Falschverdächtigung, als üble Nachrede oder als Verleumdung geahndet werden", erklärt Ahlbrecht, der auch Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins ist.
Anzeigen geht meist auch online
Neben der Strafanzeige gibt es auch den Strafantrag. Anders als die bloße Anzeige eines Sachverhalts ist das die ausdrückliche schriftliche Erklärung, dass der Antragsteller die Strafverfolgung wünscht. Antragsdelikte sind etwa Hausfriedensbruch und Beleidigung. In der Regel kann nur der Geschädigte selbst oder dessen gesetzlicher Vertreter einen Strafantrag stellen. Dafür gilt eine Frist von drei Monaten, beginnend mit dem Tag, an dem die oder der Antragsberechtigte von Tat und Täter Kenntnis erlangt hat. Anders als eine Anzeige kann man einen Strafantrag auch zurückziehen.
Es gibt drei Möglichkeiten, die Anzeige aufzugeben: auf der Polizeiwache, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft oder in vielen Bundesländern auch per Online-Verfahren. "Bei der Polizei kann die Anzeige mündlich zu Protokoll gegeben werden", erklärt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Sie muss von den Strafverfolgungsbehörden in jedem Fall entgegengenommen werden. Eine Strafanzeige kann auch direkt bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden, am besten schriftlich, empfiehlt die Ministeriumssprecherin.
In vielen Regionen Deutschlands - ausgenommen sind Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und das Saarland - können Strafanzeigen auch online gestellt werden. Egal welchen Weg man wählt: In allen Fällen müssen die klassischen W-Fragen beantwortet werden. Was ist wann, wo und wie passiert und wer wurde geschädigt? Auch persönliche Daten wie Name, Adresse und Geburtsdatum muss man angeben. Wer Beweise hat, etwa Handybilder, sollte die ebenfalls beizufügen.
Oft wird das Verfahren eingestellt
Polizei und Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, einer Strafanzeige nachzugehen und die Angaben zu überprüfen. "Im ersten Schritt müssen die Behörden ausloten, ob sie einen Anfangsverdacht strafbaren Verhaltens bejahen und damit eine Person oder auch mehrere zu Beschuldigten machen", erläutert Ahlbrecht. Zur Überprüfung, Bestätigung oder Entkräftung des Anfangsverdachts können beispielsweise Zeugen und Beschuldigte vernommen werden. Um an Beweismittel zu gelangen, kann es auch Durchsuchungen geben. Am Ende eines solchen Ermittlungsverfahrens ist es Sache der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob sich der Tatverdacht bestätigt hat oder nicht.
Das Verfahren wird eingestellt, wenn der Straftatbestand nicht ausreichend bewiesen ist. Der Antragsteller wird dann schriftlich informiert. Ist er der Geschädigte und mit der Verfahrenseinstellung nicht einverstanden, kann er Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft einlegen. Votiert auch diese Behörde für eine Verfahrenseinstellung, dann kann der Betroffene in bestimmten Fällen ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren anstrengen.
Bestätigt sich indes der Anfangsverdacht, dann wird ein Strafbefehl beim zuständigen Amtsgericht beantragt oder Anklage zu Gericht erhoben. Grundsätzlich gilt: "Sinn und Zweck der Strafanzeige ist es, den Staat auf ein - mögliches - strafbares Geschehen hinzuweisen", erläutert Ahlbrecht. Eine Aufklärung liegt schließlich im Interesse der Allgemeinheit.
Quelle: ntv.de, ino/dpa