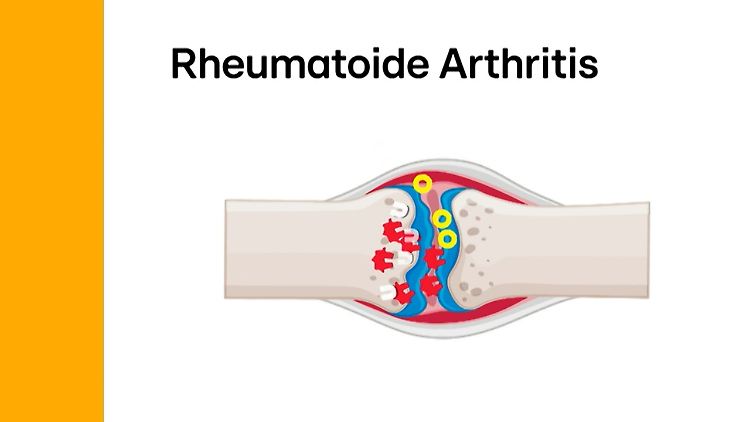Einzige fliegende Sternwarte der Welt SOFIA landet in Deutschland
17.09.2011, 14:50 UhrSOFIA, die weltweit einzige fliegende Sternwarte, ist erstmals in Deutschland gelandet. Sie befindet sich in einer umgerüsteten Boeing, die mit Tempo 800 den Geheimnissen des Universums hinterherjagd.
Wenn sich im Rumpf eines Jumbo-Jets mitten im Flug ein großes Loch auftut, bleibt den Passagieren in der Regel nur ein letztes Stoßgebet zum Himmel. Anders bei der Großraum-Boeing mit der Aufschrift SOFIA, die den Kölner Flughafen ansteuerte und dort erstmals auf europäischem Boden landete: Die Maschine ist die einzige fliegende Sternwarte der Welt - mit einem in Deutschland gebauten Teleskop an Bord, das sich hermetisch abgeschottet von der Kabine hinter einer Roll-Luke am Flugzeugheck verbirgt. Während des Fluges hoch über der Erde öffnet sich dann die Teleskop tür und gestattet den Wissenschaftlern tiefe Blicke ins All.

Bei der fliegenden Sternwarte handelt es sich um eine umgerüstete Boeing 747SP.
(Foto: ASSOCIATED PRESS)
SOFIA steht für "Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie", ein gemeinsames Projekt der US-Weltraumbehörde NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Nach ihrer Stippvisite in der Domstadt fliegt die umgerüstete Boeing 747SP, die in den vergangenen Monaten ihre ersten Beobachtungsflüge absolvierte, am Montag zu einem dreitägigen Besuch nach Stuttgart weiter - der wissenschaftliche Betrieb von SOFIA wird auf deutscher Seite von der Stuttgarter Universität koordiniert. Stationiert ist der Jumbo auf dem Dryden Flight Research Center der NASA in Palmdale (US-Bundesstaat Kalifornien).
"SOFIA ist vergleichbar einem Weltraumobservatorium, das jeden Morgen nach Hause kommt", sagt Alois Himmes, SOFIA-Projektleiter des DLR. Doch warum packen Wissenschaftler ein 17 Tonnen schweres Teleskop mit 2,7Metern Spiegeldurchmesser in eine verkürzte Version des Jumbo-Jets, um dann in bis zu 14 Kilometern Höhe bei einer Reisegeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern den Geheimnissen des Universums hinterherzujagen? Die Antwort hat mit der irdischen Lufthülle zu tun, die Beobachtungen im infraroten Wellenlängenbereich von der Erdoberfläche aus kaum zulässt. Denn bis zu einer Höhe von zwölf Kilometern absorbiert der Wasserstoff in der Troposphäre die einfallende infrarote Strahlung.
SOFIA soll wichtige Fragen beantworten
Für das menschliche Auge ist Infrarotstrahlung unsichtbar, nicht aber für das Teleskop -Auge von SOFIA: Mit hochauflösenden Spezialinstrumenten wie dem deutschen Spektrometer GREAT kann das fliegende Observatorium diese Strahlung untersuchen. Astronomen erwarten davon Antworten auf wichtige Fragen. Im infraroten Bereich strahlen beispielsweise Staubwolken oder werdende Sterne, die noch von Materiewolken umgeben sind. Mit Hilfe von SOFIA wollen die Forscher nun die Entwicklung von Galaxien und die Entstehung von Sternen und Planetensystemen aus interstellarer Materie besser verstehen. Weitere Ziele sind die Erforschung von Planeten-Atmosphären und die Suche nach Schwarzen Löchern.
Bei diesen Forschungen hat SOFIA zwar schon lange "Konkurrenz" draußen im Weltraum: Bereits 2003 schickte die NASA ihr Infrarot-Teleskop "Spitzer" ins All, 2009 folgte das europäische Weltraumteleskop "Herschel", das ebenfalls im Infrarot-Bereich arbeitet. Im Vergleich mit SOFIA weisen diese Satelliten-Teleskop e aber langfristig Nachteil auf: Einmal ins All gestartet, sind sie technologisch nicht nachrüstbar. Bei SOFIA hingegen sind Modernisierungen je nach technologischem Fortschritt jederzeit möglich. "SOFIA vereinigt die Effektivität von satellitengestütztenTeleskop en mit der vergleichsweise leichten Wartung von erdgebundenen Sternwarten", beschreibt DLR-Projektleiter Himmes die Vorteile der fliegenden Sternwarte.
Astronomen erwarten "erstklassige Ergebnisse"
Insgesamt rund 20 Jahre soll SOFIA nun in Betrieb bleiben. Pro Jahr sind rund 160 astronomische Messflüge geplant, die zehn bis 15 Wissenschaftler jeweils sechs bis acht Stunden hinauf in die Stratosphäre führen werden. Dass die Flüge die Infrarot-Astronomie ein großes Stück voranbringen werden, steht für SOFIA-Programmleiter Bob Meyer von der NASA außer Frage: Er ist sicher, dass von dem fliegenden Observatorium "erstklassige astronomische Ergebnisse" zu erwarten sind.
Quelle: ntv.de, Richard Heister, AFP