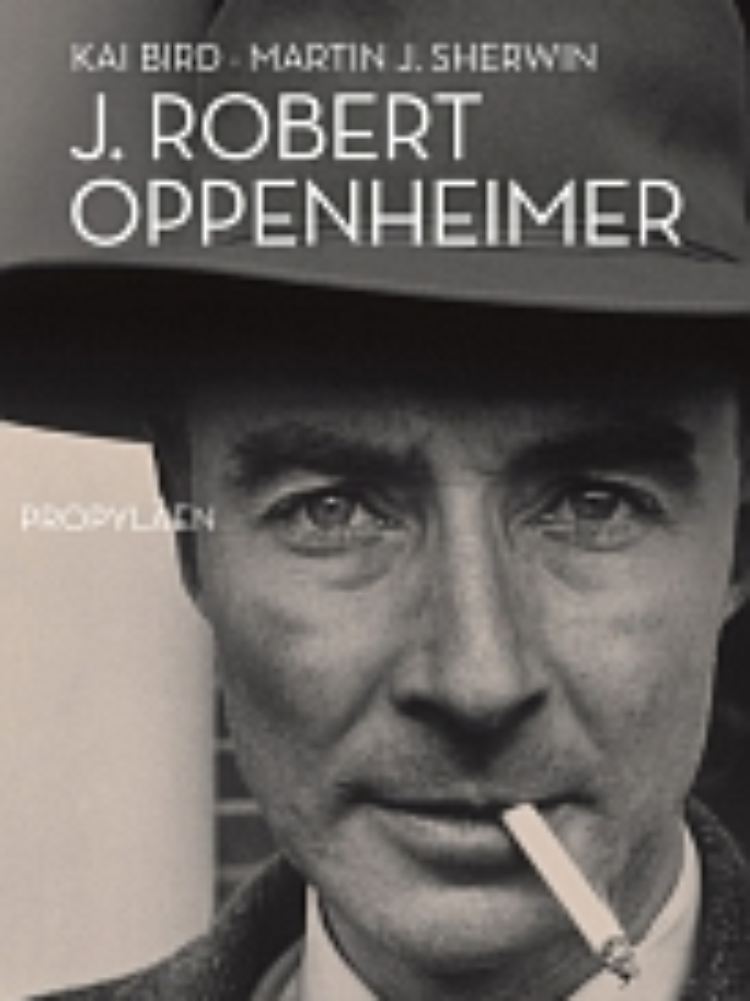"In der Sache J. Robert Oppenheimer" Erfinder einer teuflischen Waffe
06.12.2009, 00:02 UhrZuerst wurde er zum "Vater der Atombombe", dann engagierte er sich gegen ein nukleares Aufrüsten: Robert Oppenheimer hat ein faszinierendes Leben geführt
Nur über wenige Menschen lässt sich sagen, dass sie die Welt in grundsätzlich andere Bahnen lenkten. Robert Oppenheimer ist einer von ihnen: Gut sechs Jahrzehnte ist es her, dass zwei von ihm maßgeblich mitentwickelte Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki fielen. Wie aber wurde aus dem deutschstämmigen Jungen aus New York der Entwickler der zerstörerischsten Waffe der Welt? So detailliert und umfassend wie nie zuvor wird dies in der Biografie "J. Robert Oppenheimer" von Martin Sherwin und Kai Bird beschrieben. Der englische Originaltitel des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buches lautet "American Prometheus" – wegen der Parallelen Oppenheimers zu dem griechischen Gott, der den Menschen das Feuer brachte und dafür mit andauerndem Leiden bestraft wurde.
Oppenheimer (1904-1967) war ein Mann, der einen Zerstörer schuf – und sich selbst zerstörte. Er leitete das streng geheime Manhattan-Projekt, bei dem schließlich am 16. Juli 1945 die erste Test-Atombombe gezündet wurde. Der Quantenphysiker galt als hochintelligent, aber auch naiv, und er wurde zeitweise von schlimmen Depressionen und Selbstzweifeln gequält. Wie schaffte es dieser vielseitig interessierte Theoretiker, plötzlich Boss und Ideengeber tausender Mitarbeiter zu sein? Was bedeutete es für den wissenschaftlichen Direktor der militärischen Forschungsstätte Los Alamos in der Wüste New Mexicos, mit der dort entwickelten fürchterlichen Bombe Hunderttausenden Menschen Tod und Siechtum gebracht zu haben?
Akribische Recherche
Zu welchem Zeitpunkt wurde dem charmanten, bei Frauen beliebten Sprach- und Literaturliebhaber klar, dass er eine teuflische Waffe auf die Welt gebracht hatte? Und wie demütigend muss es für Oppenheimer gewesen sein, in der zutiefst antikommunistisch geprägten McCarthy-Ära (benannt nach dem Senator Joseph McCarthy) plötzlich als "Sicherheitsrisiko" verleumdet zu werden – weil er sich für einen offenen Dialog zwischen USA und Sowjetunion aussprach, um ein nukleares Wettrüsten zu verhindern?
Unglaubliche 25 Jahre Recherche liegen dem 600 Seiten starken Werk zugrunde. Rund 80 Seiten Quellenverweise belegen es: Den beiden Autoren ist wohl kein noch existierender Brief und kein Archiv entgangen, in dem Oppenheimer erwähnt wird. Sherwin und Bird haben mehr als 100 Interviews analysiert, akribisch FBI-Akten, Artikel und Protokolle studiert, etliche Tonaufnahmen abgehört und Zeitzeugen befragt. Viele von ihnen sind mittlerweile tot – die Autoren haben Unwiederbringliches gerettet. Das Ergebnis ist ein exakter Bericht über Aufstieg und Fall eines Super-Wissenschaftlers, eingebettet in die Beschreibung höchst spannender Jahrzehnte der US-amerikanischen Geschichte. Wie kaum zuvor werden die wissenschaftlichen, politischen, historischen, moralischen und persönlichen Facetten von Oppenheimers Schaffen in einem Buch zusammengefasst.
Gegen Entwicklung der Wasserstoffbombe
Als Kind sei er "gehorsam" gewesen, ein "grässlich guter Junge", der von seinen Eltern nicht darauf vorbereitet wurde, "dass die Welt voller Bitternis und Grausamkeit ist", wird Oppenheimer zitiert. Mitschüler beschreiben ihn als wissbegierigen, strebsamen, aber introvertierten und im Umgang mit anderen unbeholfenen Jugendlichen. Weggefährten sind es auch, die von der großen Liebe des jungen Physikers zu der schönen Jean Tatlock erzählen, die ihm die Politik und vor allem kommunistische Ansichten näher brachte.
Zu lesen ist auch, wie Oppenheimer später vom Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr inspiriert wurde, für eine offene Verständigung zwischen den USA und der Sowjetunion zu plädieren und sich gegen die Entwicklung einer Wasserstoffbombe einzusetzen. Politisch "angesagt" waren jedoch extreme Geheimhaltung gegenüber den gefährlichen "Roten" – und Oppenheimer, der sich selbst stets als loyalen, staatstreuen Regierungsberater sah, geriet unter Truman und Roosevelt auf die Abschussliste, wurde mehrfach verhört und – zu Unrecht – als russischer Spion denunziert. Die Atombombe wurde auf Jahrzehnte zum dominierenden politischen Druckmittel des Kalten Krieges. Robert Oppenheimer starb, gerade 62 Jahre alt, am 18. Februar 1967 an Krebs.
Detailreiches, faszinierendes Buch
Sherwin und Bird ist ein faszinierendes Buch gelungen, das sich über lange Strecken liest wie ein höchst gelungener Roman. Oppenheimer hat ein extrem faszinierendes Leben geführt – und den beiden Autoren ist es vortrefflich gelungen, davon zu erzählen. Sie dämonisieren den "Vater der Atombombe" nicht, sprechen ihn aber auch nicht frei von Schuld. Dank ihrer akribischen Recherche lassen sie einzelne Situationen lebendig werden, indem sie Zeugen – oder gar Oppenheimer selbst – zitieren.
Oft glaubt man genau zu spüren, was der Quantenphysiker in jenem Moment gedacht und gefühlt haben mag. Unterstützt wird dies durch die Bilder, die Oppenheimers Familie und wichtige Wegbegleiter zeigen. Trotz seiner Seitenstärke mangelt es dem Werk nie an Spannung und Dichte. Ein wahnwitzig aufwendiges und detailreiches Porträt eines Lebens und einer Zeitepoche, das sicher viele Leser in den Bann zu ziehen vermag.
Martin Sherwin, Kai Bird: In der Sache J. Robert Oppenheimer, Propyläen Verlag, Berlin, 512 Seiten, mehrere Bilder, 29,95 Euro, ISBN: 9783549073582
"In der Sache J. Robert Oppenheimer" im n-tv Shop bestellen
Quelle: ntv.de, Annett Klimpel, dpa