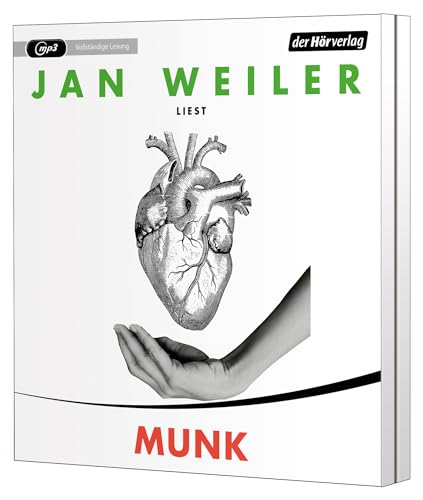Jan Weiler und die MidlifecrisisHerzkasper, Frauen und eine Vaterkiste
 Von Solveig Bach
Von Solveig Bach
Nach einer Erkrankung ändert sich der Blick auf das eigene Leben. So ergeht es Peter Munk im neuen Roman von Jan Weiler. Aber was hat der Herzinfarkt mit den 13 Frauen zu tun, denen Munk bisher begegnet ist?
Leserinnen und Leser der "Neuen Zürcher Zeitung" könnten sich bei Jan Weilers neuem Roman "Munk" die Augen reiben. Denn sie konnten die Geschichte um den Architekten Peter Munk, der auf einer Rolltreppe in einem Zürcher Kaufhaus einen Herzinfarkt erleidet, bereits 2023 und bis ins Frühjahr 2024 als Fortsetzungsroman verfolgen. Ältere Menschen können sich an dieses Format aus den Tageszeitungen ihrer Kindheiten und Jugend vielleicht noch erinnern. Weilers Roman trug jedenfalls in der NZZ den Titel "Die Summe aller Frauen".
Und auch wenn sich der Titel nun noch einmal geändert hat, beschreibt der ursprüngliche Arbeitstitel die Geschichte ziemlich präzise. Denn der 51-jährige Munk landet nach seinem gesundheitlichen Notfall, dem möglicherweise die Sichtung seiner aktuellsten Ex-Freundin vorausgegangen ist, nicht nur in einer Lebenskrise, sondern auch im Sanatorium. Und dort, im idyllisch gelegenen Mönchhof-Resort, stellt ihm sein Psychotherapeut die Aufgabe, er solle sich über die Beziehungen seines Lebens Gedanken machen und eine Aufstellung der wichtigsten Personen anfertigen.
In einer etwas verzweifelten Volte entschließt sich Munk, seine familiäre Herkunft außen vor zu lassen und sich auf die Frauen zu konzentrieren, denen er im Laufe seines Lebens mehr oder weniger sein Herz geschenkt hatte. Oder mit denen er eben Sex hatte. Die 13 Namen bringt er in eine chronologische Reihenfolge und arbeitet diese Liste und sich selbst an seiner Beziehungslosigkeit ab. Denn Peter Munk kann in seinem 51. Lebensjahr einige berufliche Erfolge, ein gediegenes Leben und auch finanziellen Wohlstand vorweisen, leider ist er aber weitgehend ohne soziale Bindungen.
Das geht so weit, dass er sich eigentlich nur von seiner Zugehfrau verabschieden muss, als er seine Auszeit startet. In der Gesellschaft von Managern und Unternehmensberatern macht sich Munk an seine Lebensbilanz, denn nach einem eher überschaubaren Eingriff am Herzen sind seine körperlichen Probleme schnell behoben. Und obwohl sich der Rekonvaleszent vermeintlich auf sein Liebesleben konzentriert, ist der Vater allgegenwärtig.
Ein moralisch verderbter Erzeuger
Während Munk die Beziehungen Revue passieren lässt, drängt sich sein Vater immer wieder in den Vordergrund. Er ist der Grund für das Scheitern der ersten Liebe, denn Munks Vater macht den Vater der Jugendfreundin geschäftlich fertig, die Munk daraufhin in einem Akt gelebter Familienloyalität keine Chance mehr gibt. Mit Genugtuung stellt Munk fest, dass die schlecht gebauten Häuser des Vaters schon zu dessen Lebzeiten wieder abgerissen werden müssen, außerdem sind sie so hässlich, dass der Sohn sein ganzes berufliches Leben der Aufgabe widmet, bessere Häuser zu entwerfen.
Die Ungeheuerlichkeit des moralisch völlig verderbten Erzeugers wird aber nach dessen Tod klar, als Munk Aktenordner voller Papiere findet. In ihnen dokumentiert der Vater seine Affären und die damit verbundenen Abtreibungen und Demütigungen genauso akribisch wie seine erpresserischen Briefe an Beamte, Mitarbeiter, Lieferanten oder Kunden. Da erscheint es nur logisch, dass er dessen bauliches wie menschliches Vermächtnis völlig ausradiert und dem Vor- auch jegliche Nachfahren verweigert.
Die entschiedene Kinderlosigkeit Munks macht wiederum seine Beziehungen schwierig. Vor allem aber scheitert der Architekt mit dem ausgewählten Musikgeschmack und der kleinen Japan-Macke an seinem Faible für leicht verrückte und aufregende Frauen. Wenn diese sich ihm provokant genug nähern, ist er sofort bereit, sein Leben über Bord zu werfen. Manchmal wollen das die Frauen gar nicht, aber Munk hat auch keine Ahnung, wie aus einer Begegnung ein wirkliches gemeinsames Leben werden könnte. Das wird besonders im etwas überraschenden Epilog des Romans deutlich, der ein wenig den Eindruck macht, der Autor habe seiner Figur kein Happy End gönnen wollen.
Zwölf Stunden Weiler
Jedenfalls wächst einem der schrullige Architekt mit dem Kindheitstrauma und der emotionalen Unerreichbarkeit irgendwie ans Herz. Obwohl Weiler in Munk einen dermaßen drögen Anfang-Fünfziger zeichnet, dass man fürchtet, die Buchseiten könnten beige werden. Gleichzeitig streut er aber immer wieder Situationen ein, die einen beim Lesen schmunzeln lassen.
Seien es die Fetisch-Klassenzimmer oder Operationssäle, die der Architekt für gut zahlende Kunden als Teil repräsentativer Stadtvillen baut oder die Ratespiele mit Birgit, die im Mönchhof-Resort eincheckt, um ein wenig auszuspannen. Bei dem Spiel geht es darum, den beruflichen Hintergrund der meist männlichen Patienten und ihre Zipperlein möglichst genau zu erraten. Birgit ist darin extrem talentiert, Munk nicht.
Jan Weiler liest das Hörbuch selbst, mit einem leicht ironischen Unterton. Munks Überlegungen verleiht er eine gewisse Dringlichkeit und Vehemenz, gleichzeitig klingen immer wieder das Selbstmitleid und die Spießigkeit des Architekten mit dem offenbar gebrochenen Herzen durch. Weiler ist ein überzeugender Munk und natürlich mit den manchmal etwas verschrobenen Worten, die er seiner Figur in den Mund gelegt hat, mehr als vertraut. So werden aus den 380 Seiten des Buches fast zwölf Stunden Hörbuch, die durchaus vergnüglich vergehen.
Danach allerdings möchte man diesem Peter Munk dringend das Konzept von Psychotherapie vermitteln. Und irgendwie wünscht man ihm sehr viel Liebe, aber vielleicht eher die eines Haustiers als die einer Frau.