Jagd auf Einsteins Gravitationswellen Astronomen wiegen Planeten
29.08.2010, 15:17 Uhr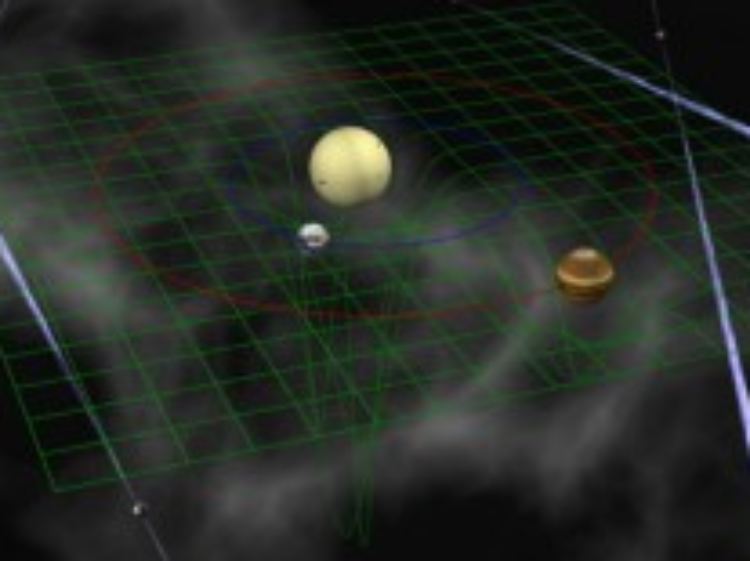
Schematische Darstellung des Messverfahrens: Die Massen von Sonne und Planeten beeinflussen die Ankunftszeit der Pulsarsignale auf der Erde
Mit den Signalen kosmischer Leuchtfeuer haben Bonner Radioastronomen erstmals die Planeten unseres Sonnensystems komplett mit ihren Monden und Ringen gewogen. Die neuartige kosmische Waage ist derzeit auf 0,03 Promille der Erdmasse genau, wie die Forscher um David Champion im "Astrophysical Journal” berichten. Die Messgenauigkeit lässt sich noch steigern. Ziel der Methode ist es aber vor allem, die von Albert Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagten Gravitationswellen aufzuspüren. Für sie gibt es trotz jahrzehntelanger Forschung bislang keinen direkten Nachweis.
Das internationale Team um Champion nutzt für seine Methode die extrem regelmäßigen Radiopulse bestimmter Neutronensterne, sogenannter Pulsare. Dabei handelt es sich um ausgebrannte Sternleichen, die sehr schnell rotieren und dabei wie ein Leuchtfeuer einen Strahl im Bereich der Radiowellen ins All senden, der dann regelmäßig über die Erde streicht. Der Takt dieser Pulsare ist so stabil, dass sich Uhren daran eichen lassen. Allerdings lässt sich dieser genaue Takt auf der Erde nicht direkt messen, weil sich unser Heimatplanet auf seiner Bahn um die Sonne mal auf den Pulsar zu- und mal wieder wegbewegt. "So werden die Messungen der Taktrate verzerrt, ganz so wie ein Zugreisender entgegenkommende Züge in kürzerem Abstand wahrnimmt als sie tatsächlich verkehren”, erläutert das Institut.
Um diese Schwankungen auszugleichen, betrachten die Forscher das sogenannte Baryzentrum des Sonnensystems. Das ist derjenige Punkt im Raum, um den alle Planeten kreisen. Dort kommen die Radiosignale der Pulsare mit perfekt gleichmäßiger Taktrate an. Dieses gemeinsame Rotationszentrum der Planeten lässt sich aus der Umlaufzeit und der Masse aller Planeten, einschließlich ihrer Monde und Ringe, errechnen. Die Umlaufzeit der Planeten ist sehr genau bekannt. Ist der Wert für die Masse nicht exakt, zeigt sich in dem Pulsartakt am berechneten Baryzentrum eine periodische Schwankung mit der Umlaufzeit des betreffenden Planeten. Eine Schwankung im Rhythmus von zwölf Jahren weist etwa auf einen Fehler bei der verwendeten Masse des Riesenplaneten Jupiter hin.
Präzisere Messungen
Für ihre jetzt veröffentlichte Arbeit nutzten die Forscher die Beobachtungsdaten von vier Pulsaren und bestimmten daraus die Massen für die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Für Jupiter ergibt sich eine Gesamtmasse – einschließlich aller seiner Monde und Ringe – von 0,9547921 Promille der Sonnenmasse. Mit einer Genauigkeit von 200 Billiarden Tonnen ist dieses Ergebnis besser als die Messungen der "Voyager”- und "Pioneer”-Raumsonden, allerdings weniger genau als der von der Jupitersonde "Galileo” ermittelte Wert. Die Präzision der kosmischen Waage lässt sich aber nahezu beliebig steigern, wie Champion betont: "Mit Beobachtungen von insgesamt 20 Pulsaren über einen Zeitraum von sieben Jahren könnte man die Masse des Jupitersystems genauer bestimmen als mit jeder Raumsonde.” Außerdem erlaubt die Pulsarmethode eine direkte Messung der Gesamtmasse eines Planeten einschließlich seiner – möglicherweise noch unentdeckten – Monde und Ringe.
Ihre eigentliche Bedeutung bekommt die kosmische Waage jedoch an einer ganz anderen Stelle: "Wir Astronomen benötigen die extrem genauen Zeitreihenmessungen von Pulsaren, um nach Gravitationswellen zu jagen, wie sie Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt”, sagt Michael Kramer, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und Leiter der Forschungsgruppe Radioastronomische F undamentalphysik.
Gravitationswellen entstehen, wenn sich das Gravitationsfeld ändert und verzerren das Raumzeit-Kontinuum. Gr undsätzlich erzeugt der Theorie zufolge auch die Erde bei ihrer Bahn um die Sonne Gravitationswellen, messbar ist das Phänomen derzeit allerdings bestenfalls bei gewaltigen Ereignissen wie der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher. Der Nachweis von Gravitationswellen könnte Astronomen ein ganz neues Fenster ins Universum eröffnen, durch das sich ganz andere Eigenschaften und Bereiche des Weltalls beobachten ließen. Auch in den Pulsar-Signalen sollten sich die Gravitationswellen durch leichte Schwankungen im Takt bemerkbar machen. "Nachweisen können wir sie aber nur, wenn wir alle potenziellen Fehlerquellen ausschalten”, sagt Kramer. "Also müssen wir auch die Verzerrungen korrigieren, die falsche Planetenmassen in der Pulsrate am Baryzentrum hervorrufen.”
Quelle: ntv.de, dpa







