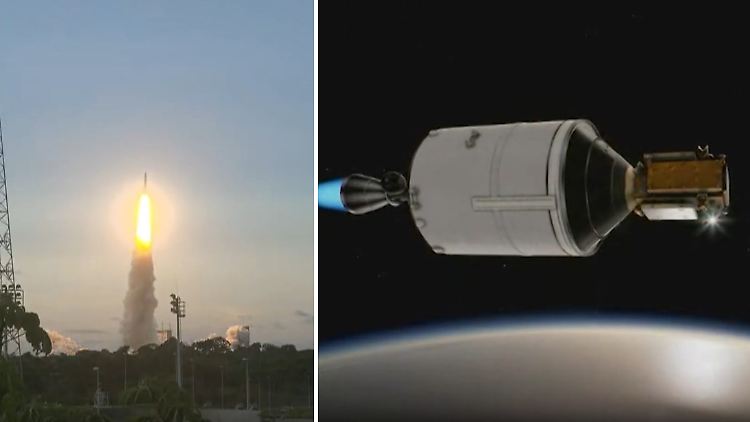Am Puls der Ozeane Datennetze im Meer
30.01.2008, 12:50 UhrEin Kabelgewirr ragt aus einer gelben Box auf einem grauen Gerüst mit vier gezackten Metallrädern. Ein bisschen wie eine fliegende Untertasse sieht das seltsame Gefährt aus - aber nicht der Weltraum wird mit seiner Hilfe erforscht, sondern der Ozean. Der Unterwasserroboter C-Move, der dem Bremer Forschungszentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM)gehört, taucht regelmäßig bis auf den Boden europäischer Meere. Die Vorbereitungen für seinen nächsten Einsatz laufen derzeit auf Hochtouren: Schrauben werden ersetzt, Teile ausgetauscht und Sonden montiert. Noch können die Informationen, die das Gerät bei seinen Tauchgängen sendet, aber nur von wenigen Spezialisten abgefragt werden.
Ab 2009 soll sich das ändern: Dann könnte der Roboter an die Schnittstellen des "Esonet" andocken, einem neuen Netz von zwölf Tiefwasser-Forschungsstationen in europäischen Meeren. Daten wie die Wassertemperatur oder die Strömungsrichtung sollen damit über Internetsuchmaschinen auffindbar und für jedermann nutzbar sein. 80 internationale Meeresforscher haben sich in diesen Tagen in Bremen mit dem rund 220 Millionen Euro teuren EU-Projekt beschäftigt. "Ziel ist es, Daten für alle Fachrichtungen an einem Ort zu sammeln - für Geowissenschaftler, Chemiker und Ozeanographen", erläutert Christoph Waldmann vom Marum, Mitglied der zehnköpfigen "Esonet"-Steuerungsgruppe.
Mit den Daten in die Zukunft schauen
Die Messgeräte, die unter anderem in der Arktis, vor der Küste Irlands und im Mittelmeer eingesetzt werden, sollen über eigens verlegte Unterwasserkabel ständig mit Strom versorgt werden und ihre Daten in Echtzeit an Land senden. "So können erstmals permanent Daten erhoben werden, mit denen wir in die Zukunft schauen können - zum Beispiel im Bereich der Erdbebenvorhersage", sagt Waldmann.
Großen Forschungsbedarf sieht der Meeresgeologe auch beim Thema Klimawandel. "Wir wissen nicht, ob es sich dabei tatsächlich nur um eine langsame Temperaturerhöhung handelt. Manche Prozesse entwickeln eine unglaubliche Dynamik, schnell passiert etwas Unvorhersehbares." Auch sei ein wichtiges Teilchen im Klimapuzzle, das Absinken von Wasser in der Arktis, bisher nur unzureichend erforscht. In den neuen Messstationen, den Observatorien, sollen aber auch ganz neue Geräte zum Einsatz kommen. Sensoren sollen verschiedenste Arten von Bakterien aufspüren und automatisch ihre Gensequenzen analysieren.
Probleme mit der Stromversorgung
Allerdings gibt es bei der Umsetzung des Projekts noch einige Probleme. "Die Sicherstellung einer durchgehenden Stromversorgung der Observatorien, die teilweise 100 Kilometer von der Küste entfernt sind, erweist sich als technisch schwierig", sagt Waldmann. Auch müssten zunächst Standards für die Ausstattung der Observatorien festgelegt werden, so dass alle Forscher aus insgesamt 14 Ländern eigene Geräte anschließen können. "Das funktioniert wie Plug and Play am Computer", erläutert Waldmann. Bevor im Jahr 2009 das erste Gerät angeschlossen werden kann, sind außerdem noch rechtliche Fragen zu klären. Im Schwarzen Meer sollten zum Beispiel die Auswirkungen von Ölbohrungen untersucht werden, hier wolle man mit den Ölfirmen zusammenarbeiten.
Um ein wirkliches Netzwerk von Tiefseeforschern um ganz Europa herum zu schaffen, reichten außerdem die Mittel von der Europäischen Kommission nicht aus. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) müssten in die Finanzierung einsteigen - obwohl es sich im Vergleich zur Weltraumforschung um kleine Beträge handele. "Es ist aber sicher, dass Observatorien als Pulsmessgeräte des Ozeans vollkommen neue Erkenntnisse liefern werden", betont Waldmann. "Die Erforschung des Ozeans ähnelte bisher dem Versuch, sich ein Bild von einer riesigen, dunklen Lagerhalle zu machen, in der wir hier und dort mal ein Streichholz anzünden - mit dem "Esonet" soll sich das ändern."
Von Astrid Brüggen, dpa
Quelle: ntv.de