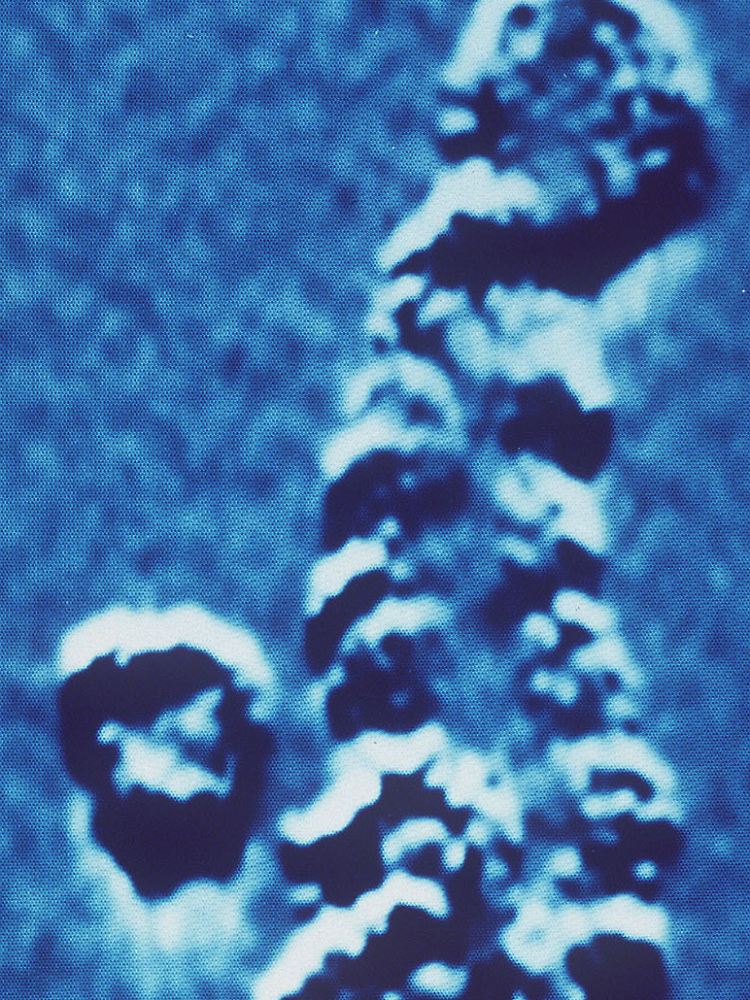Die erste Seite im Buch des Lebens Forscher entschlüsseln Chromosom 22
30.11.2009, 08:57 UhrVor zehn Jahren wurde die Sequenz des Chromosoms 22 veröffentlicht. Heute ist die Genforschung viel weiter. Aber die komplexen Vorgänge in den Zellen sind unklärt.

Für die medizinische Forschung wird insbesondere das Sequenzieren individueller Genome immer wichtiger.
(Foto: ASSOCIATED PRESS)
Als Meilenstein wurde der Artikel gefeiert, der am 2. Dezember 1999 im Fachmagazin "Nature" erschien: Rund 200 Autoren um den Briten Ian Durham von der Elite-Universität Cambridge veröffentlichten erstmals die vollständige Sequenz des Chromosoms 22 - bis auf eine kleine Lücke von drei Prozent. "Es ist der erste Hinweis darauf, dass wir das menschliche Erbgut vollständig verstehen können", jubelte seinerzeit der US-Genomforscher Adam Felsenfeld. Die Forschung hat sich seitdem rasant entwickelt. Die komplexen Vorgänge in den Zellen sind aber noch lange nicht verstanden.
Die Entzifferung des zweitkleinsten der 24 menschlichen Chromosomen war Teil des Humangenom-Projekts (HGP), an dem sich mehr als tausend Forscher weltweit beteiligten, darunter auch Deutsche. Im britischen Sanger-Zentrum analysierten Datenbankspezialisten und Molekularbiologen Seite an Seite die Anordnung der Basen Cytosin, Guanin, Adenin und Thymin. "Hunderte von Sequenzier-Maschinen standen in einem Raum groß wie eine Turnhalle, das war schon beeindruckend", erinnert sich der Leiter des Instituts für Humangenetik am Münchner Helmholtz-Zentrum, Thomas Meitinger, an einen Besuch in Cambridge.
Menschliches Genom vollständig entschlüsselt
Die öffentlich geförderten Forscher wurden von einem privaten Akteur unter Druck gesetzt: Der Genforscher Craig Venter wollte mit seiner Firma Celera Genomics als erster das gesamte menschliche Erbgut vorlegen. Auch die Veröffentlichung der Chromosom-22-Sequenz konnte nicht verhindern, dass Venter im April 2000 die Entschlüsselung eines vollständigen menschlichen Genoms verkündete. Kritiker warfen ihm vor, ungenau gearbeitet und von den öffentlich zugänglichen Daten des HGP profitiert zu haben.
Seit 2003 ist auch das Humangenom-Projekt offiziell beendet, die mehr als drei Milliarden Basenpaare der menschlichen DNA sind bekannt. Heute weiß man auch, dass der Mensch nur etwa 20.000 Gene hat, nicht viel mehr als eine Fliege. "Wichtig ist, was einzelne Organismen aus den Genen machen", erklärt Meitinger. Die Forscher blicken längst nicht mehr nur auf das Erbgut; sie vergleichen Genome verschiedener Organismen und das Zusammenspiel von Genen und Proteinen in den Zellen. Mit Laborexperimenten allein könnten die komplexen Prozesse nicht nachvollzogen werden, sagt der Genetiker Jörn Walter von der Universität des Saarlandes. Die Arbeit des Genomforschers werde deshalb immer mehr zur "Computerarbeit".
Kostspielige Kartierung der Epigenome
Besonders Walters Fachgebiet, die Epigenetik, gilt als vielversprechend, was die Behandlung von bestimmten Blutkrebserkankungen und bösartigen Tumoren angeht. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass auch Umwelteinflüsse und chemische Prozesse im Körper die Ausprägung eines Gens beeinflussen - und dass diese Eigenschaften sogar vererbt werden, auch wenn sie nicht auf der DNA festgelegt sind. "Epigenetische Veränderungen scheinen auch dazu beizutragen, dass Zellen bösartig werden", sagt Walter. In der Hoffnung auf wirksame Medikamente investieren die USA nach seinen Angaben hunderte von Millionen Dollar in die Kartierung der Epigenome. Hierzulande fördert die Bundesregierung das Nationale Genomforschungsnetzwerk von 2008 bis 2013 mit mehr als 150 Millionen Euro.
Für die medizinische Forschung wird nach Angaben des Münchner Professors Meitinger das Sequenzieren individueller Genome immer wichtiger. Hier sei die größte Herausforderung für die Forscher, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, sagt Meitinger. Denn genetische Informationen über Einzelne könnten schließlich auch missbraucht werden: "Wir müssen immer wieder auch öffentlich diskutieren, wo die Forschung hingehen soll."
Quelle: ntv.de, Claudia Wessling, AFP