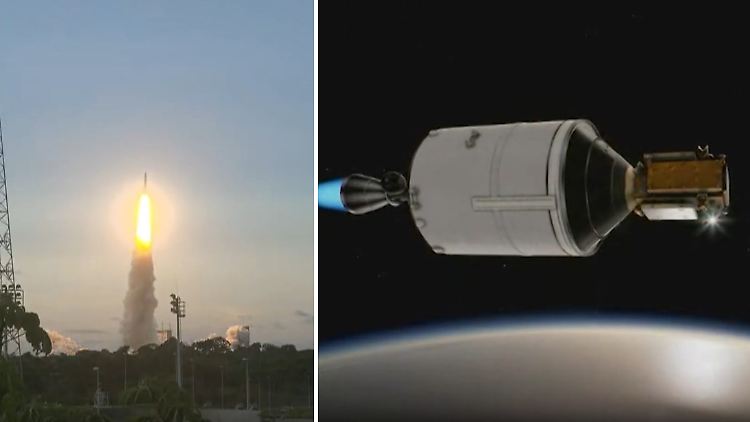Fränkisch gesucht Schüler als Dialektforscher
19.02.2009, 13:27 UhrLange hatte es der Dialekt im Deutschunterricht schwer. Wer ihn sprach, wurde belächelt, und selbst manchem Lehrer fehlt es heute noch an Lust oder Zeit, Mundart wie vorgeschrieben im Unterricht zu behandeln. Vor zehn Jahren sorgte der Fall Florian deutschlandweit für Furore. Dem Grundschüler aus Oberbayern war von seinem Lehrer vorgeworfen worden, er habe Schwierigkeiten, sich verständlich auszudrücken, da auch seine Eltern nur bayerisch sprächen. Nach öffentlichem Wirbel wurde der Bub nicht wie zunächst geplant im Zeugnis für seinen Dialekt getadelt. Die Schule habe den Auftrag, Mundart zu fördern, hieß es bereits damals beim Kultusministerium.
Zehn Jahre später fristet der Dialekt zwar in vielen Schulen noch immer ein Nischendasein, in Unterfranken dagegen sollen die Schüler mehr über das Fränkische erfahren. "Wie nennt man ein kleines Brot", scheppert es aus dem CD-Player in einer Würzburger achten Klasse. "Wegh", gibt eine ältere Frau zu Protokoll und 25 Schüler des St. Ursula Gymnasiums spitzen die Ohren.
Schüler sollen wissenschaftlich arbeiten
Mitgebracht haben dieses Hörbeispiel Wissenschaftler des Unterfränkischen Dialektinstituts (UDI) der Universität Würzburg. Mit ihrer Hilfe sollen die Schüler demnächst Dialektbefragungen durchführen, also wissenschaftlich arbeiten. Erklärtes Ziel ist das Erforschen der eigenen Mundart. Dabei geht es nicht darum, Fränkisch zu lernen und künftig "umasunst" (kostenlos), "Baddiestimmung" (Partystimmung) oder "Fliecha" (Flugzeug) zu sagen.
Bei dem Schulprojekt werden die Mädchen und Buben vielmehr sprachwissenschaftliche Untersuchungen anstellen: So sollen sie sich eine Fragestellung überlegen, dann Befragungen durchführen, die Ergebnisse auswerten und am Ende ihre Erkenntnisse auf einem Schüler-Kongress vorstellen. Eine Klasse aus Gemünden (Landkreis Main-Spessart) hat auf diese Weise bereits herausgefunden, dass Männer tendenziell mehr Dialekt sprechen als Frauen. Andere Schulen erforschten den Anteil der Dialektsprecher nach Altersgruppen. Ihr Ergebnis: Ältere Menschen sprechen deutlich mehr Mundart als jüngere.
Die Klasse des St. Ursula Gymnasiums wird ihre erste Dialektbefragung im Sommer durchführen. Dabei müsse sie einiges beachten, erklärt Dialektforscherin Monika Fritz-Scheuplein. Zum Beispiel sollten die jungen Wissenschaftler nicht die Wörter vorsprechen, die sie erfragen wollen. "Ihr müsst umschreiben oder Bilder zeigen", rät die Sprachwissenschaftlerin den Schülern. Auch Hochdeutsch sollen die kleinen Forscher bei ihren Befragungen vermeiden. "Wenn ihr gute Ergebnisse haben wollt, müsst auch ihr ein bisschen Dialekt verwenden." Denn wer nur Hochdeutsch spreche, müsse damit rechnen, dass die Interviewpartner "aus Scham" verstummen.
Innovativer Ansatz
Das Projekt namens "Fränki" ist in Bayern einmalig. "Bayerische Dialektinstitute betätigen sich hauptsächlich in der Forschung", sagt Hermann Ruch vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Eine Zusammenarbeit mit Schulen gebe es lediglich in Unterfranken. Zwar berichtet der zuständige Referatsleiter im Kultusministerium, Stefan Krimm, das Thema Dialekt ist im Lehrplan vorgesehen. "Im Schulalltag haben Deutschlehrer aber hauptsächlich mit der Vermittlung der Standardsprache zu tun." Für Forschungsprojekte mit Schülern bleibe kaum Zeit.
"Lange war Dialekt in der Schule verpönt", berichtet Norbert Wolf, Professor für Sprachwissenschaft an der Uni Würzburg. Mittlerweile gehe die Forschung jedoch davon aus, dass gerade beim Spracherwerb Dialekt eine wichtige Rolle spiele. "Es geht nicht darum, Dialekt im Unterricht aktiv zu erlernen", erklärt Wolf. Das Nachdenken über Mundart fördere vielmehr das Hochdeutsch.
Den innovativen Ansatz der Würzburger Forscher begrüßen auch Lehrer. "Der Dialekt ist im Alltag der Schüler verwurzelt", sagt der Würzburger Pädagoge Ludwig Stier. Beschäftigen sich die Schüler mit ihrem eigenen Dialekt, sei der Wunsch nach lebensnahem Unterricht mehr als erfüllt. In diesem Jahr arbeiten etwa 300 Schüler mit dem UDI zusammen. "Wir können gar nicht so viele Schulen besuchen, wie gerne mitmachen würden", sagt Dialektforscherin Fritz-Scheuplein.
Quelle: ntv.de, Hannes Vollmuth, dpa